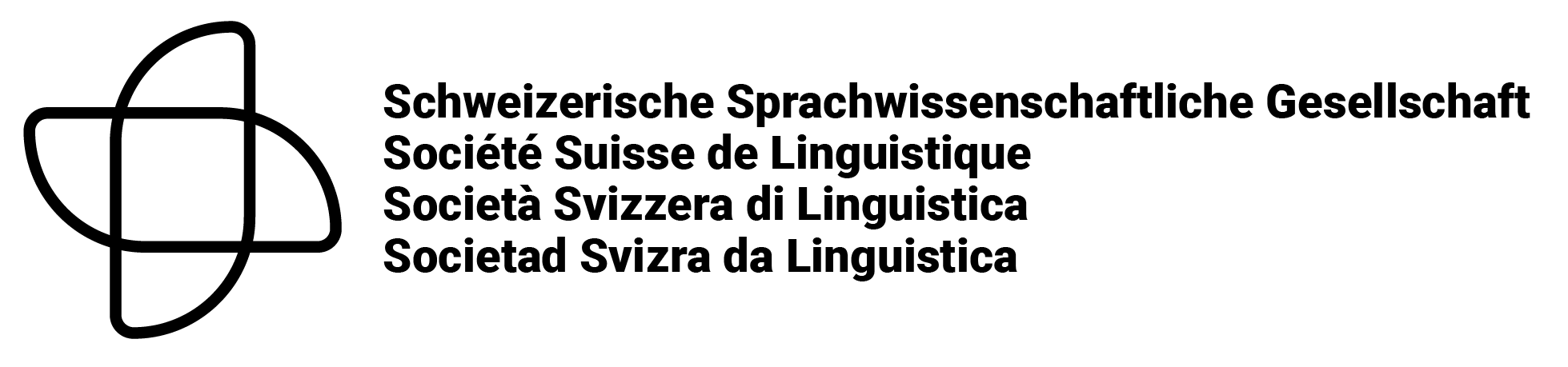Wird über Massnahmen gegen die Corona-Pandemie oder den Klimawandel diskutiert, ist oft die Forderung nach mehr Einfluss der Wissenschaft auf politische Entscheidungen zu hören. Verdichtet zum Slogan «follow the science» findet die Forderung Widerhall auf der Strasse und in den sozialen Medien. Wobei hier mit «Science» meist die Naturwissenschaften gemeint sind. Dabei schwingt Enttäuschung ebenso mit wie Hoffnung: Enttäuschung über eine Politik, die zu wenig oder das Falsche tut, und Hoffnung, dass die Politik die Probleme lösen könnte, wenn sie denn nur auf die Wissenschaft hören würde.
Diese Hoffnung ist nachvollziehbar, denn immerhin hat sich die wissenschaftliche Methode als ausserordentlich effektiv beim Lösen von Problemen erwiesen, an denen die Menschheit jahrtausendelang gescheitert war. Wir haben dank der Elektrizität die Nacht zum Tag gemacht, Hungersnöte gehören in Westeuropa auch dank technischer Fortschritte in der Landwirtschaft schon lange der Vergangenheit an1, und Impfungen und Medikamente haben viele der Krankheiten zum Verschwinden gebracht, die uns seit Menschengedenken plagten.
Die wissenschaftliche Methode hat sich als ausserordentlich effektiv beim Lösen von Problemen erwiesen, an denen die Menschheit jahrtausendelang gescheitert war.
Verglichen mit den wissenschaftlichen und technischen Fortschritten der letzten 150 Jahre scheinen die Prozesse demokratischer Staaten nicht sehr effizient und oft sogar irrational. Regulationen werden selten nach rein wissenschaftlichen Kriterien festgelegt. Die Bedürfnisse von betroffenen Industrien oder die Befürchtungen von Anwohner:innen finden im Gesetzgebungsprozess oft mehr Gehör als die Wissenschaftler:innen mit ihren Datenreihen. Zudem nutzen und verstärken populistische Parteien gezielt das Misstrauen gegenüber der Wissenschaft.
Wirkung politischer Massnahmen begrenzt messbar
Als Gegenbewegung dazu findet die Forderung vermehrten Zuspruch, dass sich die Regierung nur an Expertise und Gemeinwohl orientieren soll.2 Radikal ausgelegt führt dies zu einer Technokratie ohne Einbezug der Betroffenen in die Entscheidungsfindung. Weniger weit geht die evidenzbasierte Politik, die in den neunziger Jahren vor dem Hintergrund der evidenzbasierten Medizin populär wurde. Sie verlangt, dass politische Entscheidungen auf objektiver wissenschaftlicher Evidenz basieren sollen. Als Goldstandard gilt dabei die randomisierte kontrollierte Studie (RCT). Dieses Studiendesign stammt aus der klinischen Forschung, wo Proband:innen zufällig auf Kontroll- und Behandlungsgruppen verteilt werden und dann zum Beispiel ein Medikament, ein Placebo oder keine Behandlung erhalten. Nach einer bestimmten Zeitspanne wird die Wirkung evaluiert. Mit dieser Methode können nicht nur Medikamente, sondern auch grössere Interventionen zur Förderung der öffentlichen Gesundheit beurteilt werden. Im Rahmen evidenzbasierter Politik wurde dies auf andere Politikbereiche übertragen, etwa um den Effekt zusätzlicher Lehrpersonen auf den Lernerfolg zu prüfen.
Man muss sich fragen: Funktioniert das, was in der einen Stadt funktioniert hat, auch im Dorf nebenan, im Nachbarland, oder sogar auf einem anderen Kontinent?
Korrekt durchgeführt, können solche Studien verlässlich zeigen, ob eine bestimmte Massnahme unter den gewählten Bedingungen im Versuchszeitraum den gewünschten Effekt hatte. Allerdings sind sie aufwändig und die Aussagekraft und Übertragbarkeit der Ergebnisse oft umstritten. Man muss sich fragen: Funktioniert das, was in der einen Stadt funktioniert hat, auch im Dorf nebenan, im Nachbarland, oder sogar auf einem anderen Kontinent? Und gibt es Effekte, die nicht evaluiert wurden? Die grösste Schwäche dieser Art von Studien ist jedoch, dass sie nur bei politischen Massnahmen mit sehr überschaubaren Effekten funktionieren. Eine Verfassungsreform, die verschiedenste Lebensbereiche betrifft, lässt sich so kaum evaluieren.3
Expertise hat stets eine subjektive Komponente
Nun kann man natürlich einwenden, dass wir uns da im Bereich der Sozialwissenschaften bewegen und die Politik sich stattdessen an den exakten Wissenschaften orientieren sollte, wo allgemeingültige Gesetze gelten und die Ergebnisse nicht von den Launen der Menschen abhängen. Nur interessieren sich Entscheidungsträger:innen selten dafür, welche Gene in einer Zellkultur aktiv sind oder was die kritische Masse von Thorium ist. Sie wollen stattdessen wissen, ob eine neue Gentechnologie negative Auswirkungen auf die Umwelt hat und ob Thorium-Reaktoren sicher sind. Es geht bei politischen Entscheidungen also meist um Risiken, die niemand mit absoluter Sicherheit bestimmen kann. Genetisch veränderte Pflanzen können auf Testfeldern angepflanzt und neue Reaktortypen können in Forschungeinrichtungen geprüft werden, aber die realen langfristigen Auswirkungen der Freisetzung von Pflanzen oder dem Betrieb eines Reaktors kann die Wissenschaft nicht testen. Zwar steigt die Zuverlässigkeit der Aussagen mit der Anzahl Versuche und den Erfahrungen an verschiedenen Orten, aber es bleibt stets eine Restunsicherheit.
Es geht bei politischen Entscheidungen meist um Risiken, die niemand mit absoluter Sicherheit bestimmen kann.
Hier kommt die Expertise ins Spiel. Von Expert:innen wird erwartet, dass sie anhand ihres Wissens und langjähriger Erfahrung die Risiken besser einschätzen zu können als Laien. Expertise ist aber mehr als die Kenntnis verschiedener Studien zu einem Thema. Sie hat immer auch eine subjektive Komponente, die sie angreifbar macht.4 Wenn unterschiedliche Expert:innen zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen, liegt es an der Politik zu entscheiden, welcher Expertenmeinung sie im Gesetzgebungsprozess folgt.
Regulatorische Wissenschaft: zwischen Forschung und Verwaltung
Bei der Umsetzung von Gesetzen und Verordnungen ist es bereits seit langem üblich, dass auf der Basis von Studien, Messungen und Experteneinschätzungen etwa über die Zulassung von neuen Chemikalien oder Lärmgrenzwerte entschieden wird. Der zugrundeliegende wissenschaftliche Prozess wird als «regulatorische Wissenschaft» (Regulatory Science) bezeichnet.5 An ihr sieht man viele der Schwierigkeiten, die auftreten, wenn die Abläufe der Wissenschaft auf diejenigen der Politik und der Verwaltung treffen: Der normalwissenschaftliche Prozess verläuft langsam. Erst im Laufe der Zeit kristallisiert sich ein Konsens heraus, der sich aber auch wieder ändern kann, wenn genügend widersprechende Evidenz hinzugekommen ist. Die regulatorische Wissenschaft hat diesen Luxus nicht. Sie muss zu einem bestimmten Zeitpunkt festlegen, bis zu welchem Grenzwert eine Chemikalie unbedenklich ist oder welche Präventionsmassnahmen notwendig sind. Dabei können Falscheinschätzungen einschneidende Folgen haben. Und selbst wenn diese ausbleiben, können Behörden Regulationen nicht jederzeit und beliebig oft ändern: Dies würde das Vertrauen in ihre Fachkenntnisse beschädigen und die Rechts- und Planungssicherheit für all jene mindern, die sich an den Regulationen orientieren müssen.
Leitplanken aus der Wissenschaft für eine evidenzorientierte Politik
Aus der Fähigkeit der Wissenschaften, Lösungen für spezifische Probleme zu finden, folgt also nicht, dass «die Wissenschaft» im politischen Prozess einfach die Richtung vorgeben kann oder soll. Sinnvoller wäre eine evidenzorientierte Politik, bei der wissenschaftliche Erkenntnisse nicht die Basis für die Politik bilden, sondern die Leitplanken vorgeben. Sie bieten Orientierung, geben die möglichen Spuren vor und zeigen, was passieren könnte, wenn die Politik diese Spuren verlässt. Über die Richtung müssen jedoch Politik und Gesellschaft entscheiden. Die Entscheidungsträger:innen sollten dabei transparent sein und erklären, wieso sie welche Optionen gewählt haben.
Politiker:innen sollten die Bereitschaft mitbringen, gegebenenfalls ihre Positionen zu ändern.
Dafür braucht es gegenseitiges Verständnis und einen konstruktiven Dialog zwischen Wissenschaft und Politik. Politiker:innen sollten auf die Fachkenntnisse der Wissenschaftler:innen hören und die Bereitschaft mitbringen, gegebenenfalls ihre Positionen zu ändern. Die Wissenschaftler:innen sollten ihrerseits bereit sein, komplexe Problemstellungen transdisziplinär anzugehen und Perspektiven über ihre jeweilige Fachdisziplin hinaus zu berücksichtigen.
Referenzen
1 Die letzten Hungersnöte in Westeuropa waren eine Folge des Zweiten Weltkriegs und nicht von Ernteausfällen durch Krankheiten oder Dürren, wie sie vor 1850 häufig aufgetreten waren. Alfani, G., Ó Gráda, C. The timing and causes of famines in Europe. Nat Sustain 1, 283–288 (2018). https://doi.org/10.1038/s41893-018-0078-0
2 Caramani, D (2020). Introduction: the technocratic challenge to democracy. In: Bertsou, Eri; Caramani, Daniele. The technocratic challenge to democracy. London: Taylor & Francis, 1-26.
3 Deaton, A.; Cartwright, N. (2017). "Understanding and misunderstanding randomized controlled trials," Social Science & Medicine
4 Eyal, G. (2019). “The Crisis of Expertise”
5 Moghissi, AA; Straja, Sorin R.; Love, Betty R.; McBride, Dennis K.; Stough, Roger R. (2014). "Innovation in Regulatory Science: Evolution of a new scientific discipline". Technology & Innovation. 16 (2): 155–165
Zum Autor
Zum Autor
Michael Kümin ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT) und war zuvor bei der Grünliberalen Partei des Kantons Zürich tätig. Er hat 2017 sein Masterstudium in Molekularbiologie an der Universität Zürich abgeschlossen und absolviert derzeit einen MAS in Technologie und Public Policy an der ETH Zürich. Michael Kümin interessiert sich für Wissenschaftsvermittlung und insbesondere für den Dialog zwischen Wissenschaft und Politik.
Open Access
Dies ist eine Open-Access-Publikation, lizenziert unter CreativeCommons CC BY-SA 4.0.
Disclaimer
Die Blogbeiträge können Meinungsäusserungen der AutorInnen enthalten und stellen nicht grundsätzlich die Position der jeweiligen Arbeitgeberin oder der SAGW dar.
Titelbild
Foto von Bogdan R. Anton via pexels