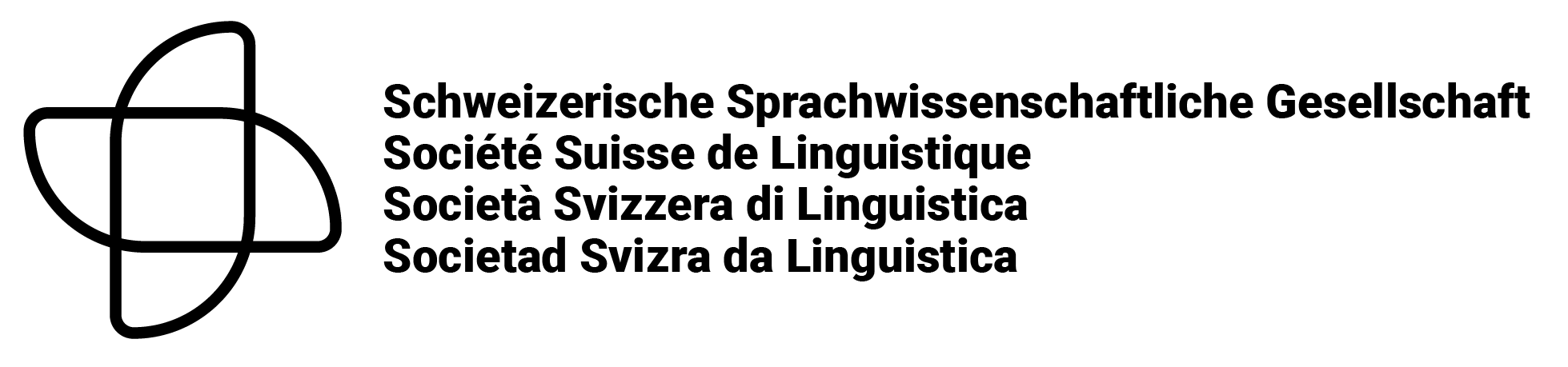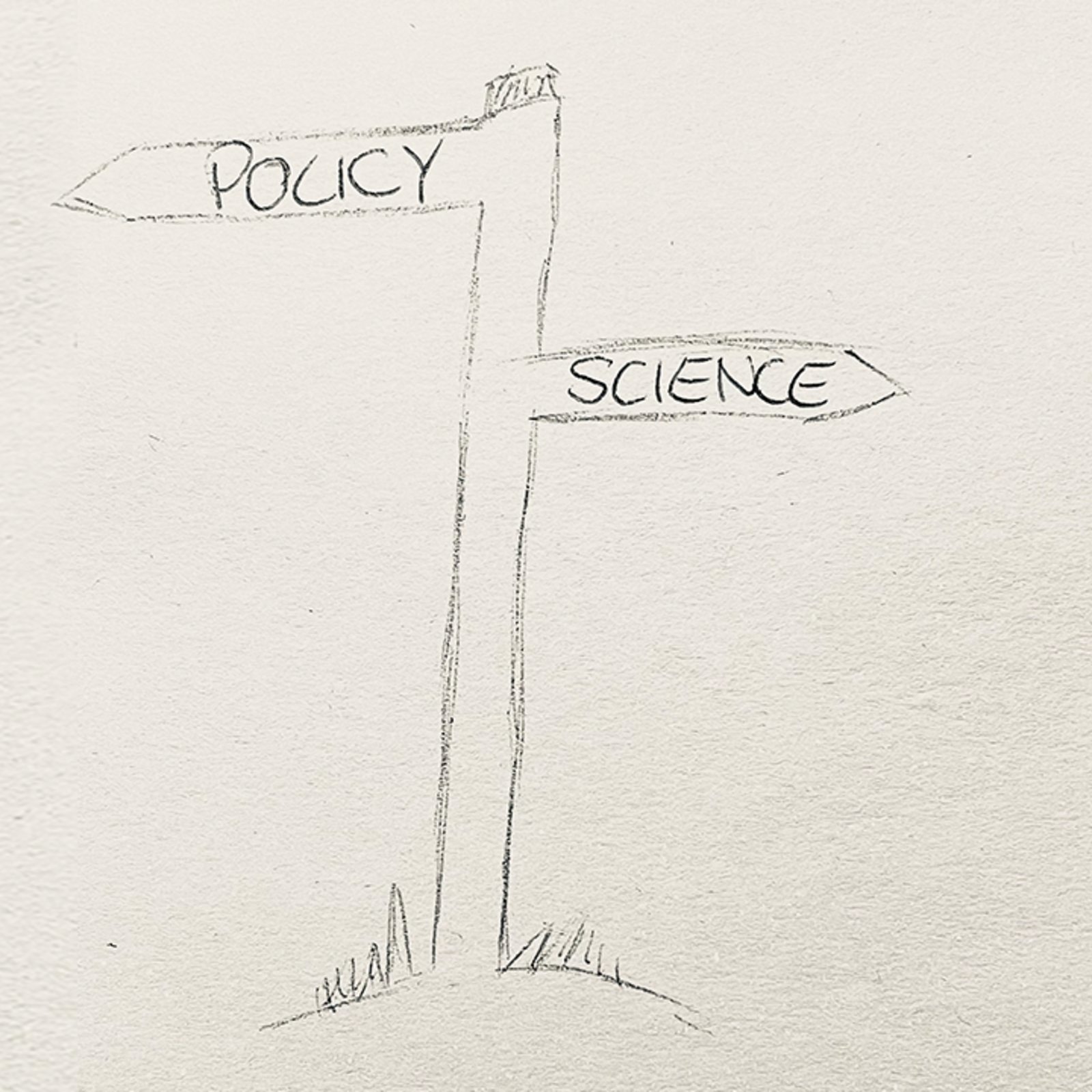Gleich mehrere parlamentarische Vorstösse fordern einen stärkeren Einbezug wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Politik. Aufgrund eines Postulats von Ständerat Matthias Michel werden momentan verschiedene Optionen geprüft, wie wissenschaftliche Expertise in Krisenzeiten besser in die Politik einfliessen kann. Zusätzlich verlangt eine Motion von Ständerat Othmar Reichmuth den Einbezug der Wissenschaft in der Klimapolitik zu stärken und die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Politik im Klimabereich zu institutionalisieren.
Der Ruf nach mehr Wissenschaft in der Politik ist nicht neu. Der Begriff der evidenzbasierten Politik wurde Ende der 1990er-Jahre in Grossbritannien in der Zeit von New Labour geprägt. Die Regierung von Tony Blair erklärte unter dem Slogan «What matters is what works», dass politische Entscheidungen nicht aufgrund politischer Ideologie sondern aufgrund wissenschaftlicher Evidenz gefällt werden sollten (Frey und Ledermann, 2010; Nutley, Walter und Davies, 2007). Tatsächlich verspricht die systematische Nutzung von Evidenz bei der Gestaltung politischer Massnahmen einige Vorteile für die Gesellschaft, beispielsweise eine effizientere Nutzung öffentlicher Mittel (Head 2008).
Zielkonflikte auf der einen Seite, Unsicherheit auf der anderen
Die Aussichten sind also vielversprechend. Dennoch darf nicht ignoriert werden, dass die Gestaltung öffentlicher Politik letztlich auch auf politischem Weg zustande kommt – und in einer demokratischen Gesellschaft soll das auch so sein. Öffentliche Politik versucht, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Was aber ein relevantes gesellschaftliches Problem ist und wie es am besten gelöst wird, muss in einem demokratischen System gesellschaftlich ausgehandelt werden. Solche Aushandlungsprozesse sind geprägt von Zielkonflikten, unterschiedlichen ideologischen Positionen und der Vertretung verschiedener Interessen. Das bedeutet, dass Entscheidungen für oder gegen bestimmte öffentliche Massnahmen nicht allein von wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern durch viele andere Einflüsse bestimmt sind.
Die Einbindung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Politik muss damit umgehen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse fortlaufend aktualisiert und teilweise revidiert werden.
Dies heisst aber nicht, dass der Einbezug wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Politik nicht gestärkt werden kann. Institutionalisierte Kanäle, über welche Wissenschaft und Politik zusammenarbeiten können, erlauben es der Politik, wissenschaftliche Erkenntnisse systematischer zu nutzen. Mit Blick auf die Wissenschaft ist jedoch auch zu beachten, dass es mitunter sehr umstritten ist, was «Evidenz» ist und das Wesen der Wissenschaft in Zweifel und nicht in Sicherheit besteht. Die Einbindung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Politik muss damit umgehen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse fortlaufend aktualisiert und teilweise revidiert werden (Bandelow et al. 2021).
Vier Vorschläge für einen funktionierenden Dialog
Was können wir für die Zukunft aus diesen Herausforderungen in der Zusammenarbeit zwischen Politik und Wissenschaft lernen?
Die Logiken der beiden Systeme verstehen
Erstens müssen beide Systeme die inhärente Logik des jeweils anderen verstehen. Die Politik hat andere Funktionen und Ziele als die Wissenschaft. Damit der Dialog zwischen Wissenschaft und Politik gelingen kann, müssen beide Seiten die Prinzipien anerkennen, welche die jeweiligen Aktivitäten strukturieren. Konkret bedeutet das, dass die Wissenschaft anerkennt, dass Politik gesellschaftliche Probleme nur durch das Generieren von Mehrheiten und Unterstützung lösen kann, während die Politik das der Wissenschaft zugrundeliegende Prinzip des Zweifels und dem Streben nach Widerlegung von als Fakten präsentierten Erkenntnissen respektiert.
Institutionen für Austausch nutzen
Zweitens braucht es institutionell verankerte aber auch informelle Möglichkeiten des Austausches zum Aufbau von gegenseitigem Vertrauen. Im schweizerischen System bieten beispielsweise Ausserparlamentarische Kommissionen oder die von der Bundesverwaltung angestossene Ressortforschung Möglichkeiten, die Wissenschaft in die Politik einzubinden. In Krisenzeiten kann es – je nach Art der Krise – sinnvoll sein, nicht nur die bestehenden Institutionen und Räume zu aktivieren und zu nutzen, sondern sie auch neu zusammenzustellen.
Akteure an den Schnittstellen einbinden
Drittens müssen Akteure an den Schnittstellen installiert und in den Dialog eingebunden werden, die im Krisenfall auf Abruf verfügbar sind, aber auch einen kontinuierlichen Austausch in Zeiten ermöglichen, die nicht krisengeschüttelt sind. Ein Beispiel sind politische Akteure mit wissenschaftlichem Hintergrund, die Verständnis für beide Systeme aufbringen, oder Forschende, die Einblick in die politischen Prozesse vermitteln. Das an der Universität Bern gegründete Multidisciplinary Center for Infectious Diseases versucht letzteres über ein Ethics and Policy Lab praxisorientiert zu bieten.
Sich international koordinieren
Viertens sind Wissenschaft und Politik gleichermassen Tendenzen der Internationalisierung unterworfen, was Kooperation und Koordination über die Landesgrenzen hinaus erfordert. Dies bietet Chancen – etwa durch länderübergreifende Lernprozesse und Datenaustausch – aber auch Risiken: Die internationale Ebene prägt noch stärker das, was als vorherrschende Evidenz gesehen wird, an der sich Regierungen orientieren sollten, sodass die Einsicht über die Unwägbarkeiten von wissenschaftlichen Evidenzen mit der Komplexität politischer Kontexte und Interessen zurückgeht.
Insbesondere vor dem Hintergrund der Instabilität von Evidenz und deren Deutung ist ein ständiges Hinterfragen von wissenschaftlichen Erkenntnissen und politischen Prozessen auf allen Ebenen notwendig, um Wissenschaft nicht zu normieren und zu politisieren.
Literatur
Bandelow, Nils C., Hornung, Johanna und Lina Y. Iskandar (2021): Expertenrat ist stark gefragt, in: Gesundheit und Gesellschaft 24,4, S. 21–25. Online: https://www.gg-digital.de/2021/04/thema-des-monats/expertenrat-ist-stark-gefragt/index.html
Frey, Kathrin und Simone Ledermann (2010): Evidence-Based Policy: A Concept in Geographical and Substantive Expansion, in: German Policy Studies 6,2, S. 1–15.
Head, Brian W. (2008): Three Lenses of Evidence-Based Policy, in: Australian Journal of Public Administration 67,1, S. 1–11. https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2007.00564.x
Nutley, Sandra, Isabel Walter und Huw T.O. Davies (2007): Using Evidence: How Research Can Inform Public Services, Bristol. https://doi.org/10.2307/j.ctt9qgwt1
Johanna Hornung ist promovierte Politologin. Ihre Forschungsinteressen liegen unter anderem im Bereich der Policy-Forschung, mit einem Fokus auf vergleichender Gesundheitspolitik.
Beide Autorinnen arbeiten als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am Kompetenzzentrum für Public Management und im Ethics and Policy Lab des Multidisciplinary Center for Infectious Diseases (MCID) an der Universität Bern.
Open Access
Dies ist eine Open-Access-Publikation, lizenziert unter CreativeCommons CC BY-SA 4.0.
Disclaimer
Die Blogbeiträge können Meinungsäusserungen der AutorInnen enthalten und stellen nicht grundsätzlich die Position der jeweiligen Arbeitgeberin oder der SAGW dar.