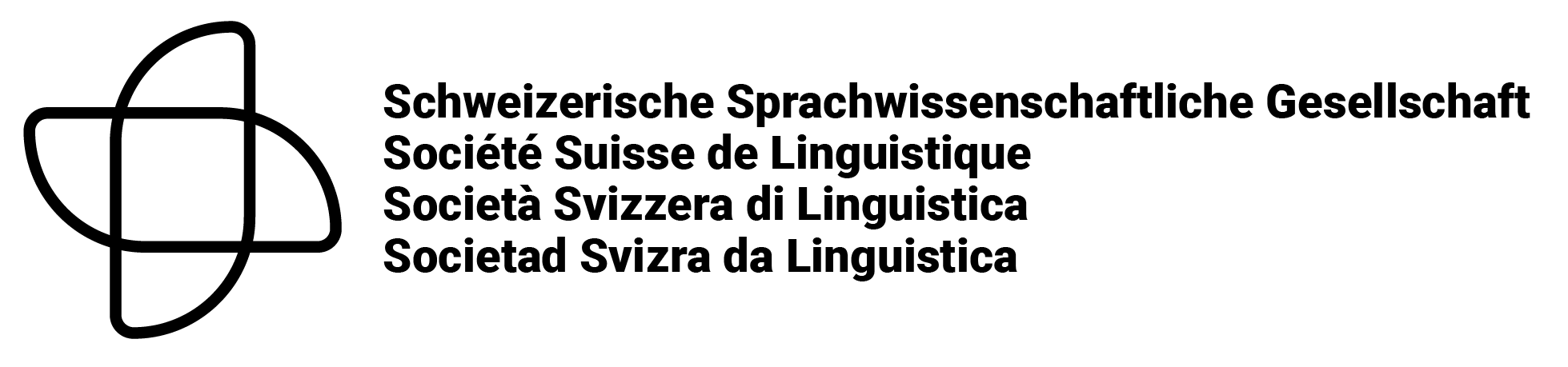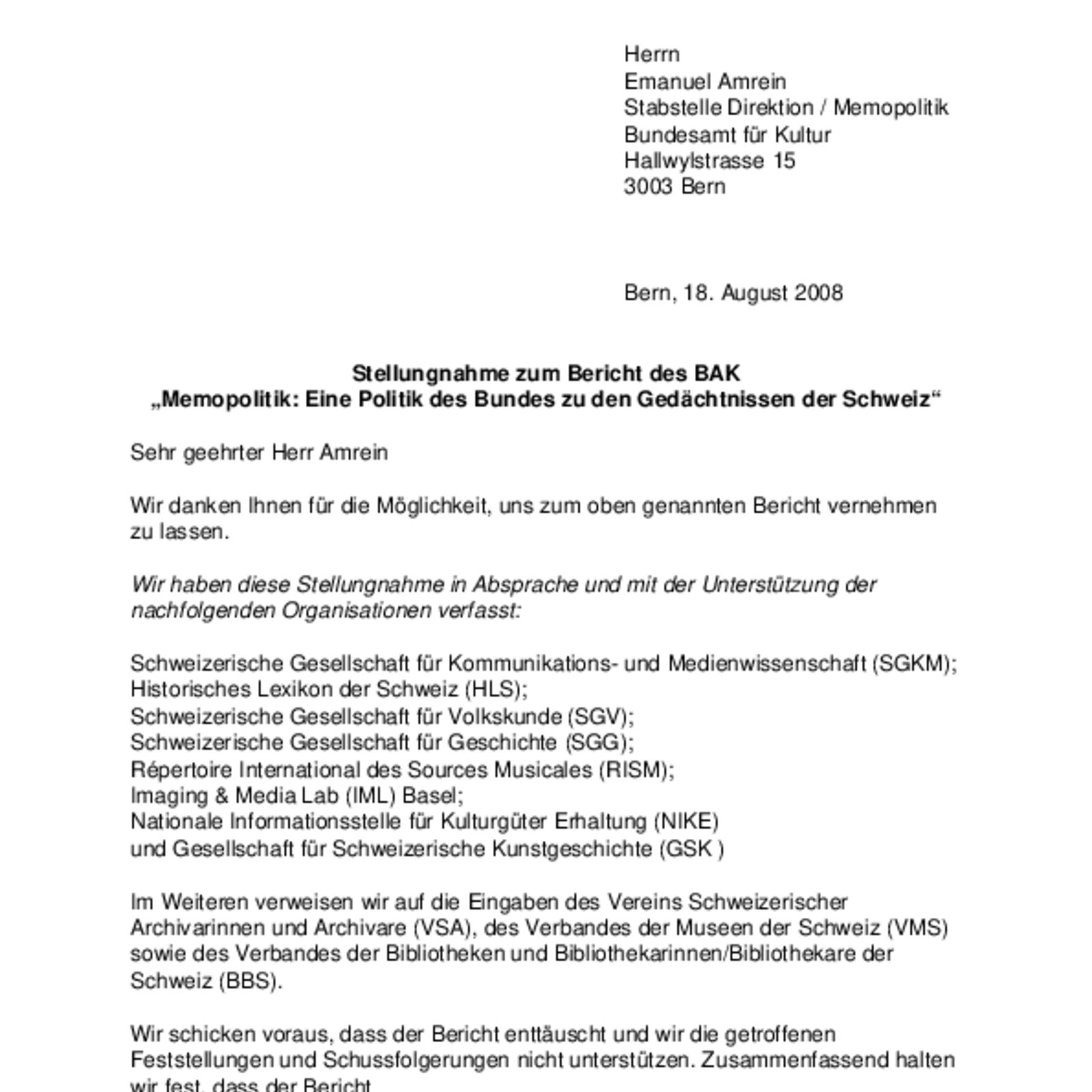Stellungnahme der SAGW zum Bericht des BAK: «Memopolitik: Eine Politik des Bundes zu den Gedächtnissen der Schweiz»
Herrn
Emanuel Amrein
Stabstelle Direktion / Memopolitik
Bundesamt für Kultur
Hallwylstrasse 15
3003 Bern
Stellungnahme zum Bericht des BAK
«Memopolitik: Eine Politik des Bundes zu den Gedächtnissen der Schweiz»
Sehr geehrter Herr Amrein
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns zum oben genannten Bericht vernehmen zu lassen.
Wir haben diese Stellungnahme in Absprache und mit der Unterstützung der nachfolgenden Organisationen verfasst:
Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft (SGKM);
Historisches Lexikon der Schweiz (HLS);
Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde (SGV);
Schweizerische Gesellschaft für Geschichte (SGG);
Répertoire International des Sources Musicales (RISM);
Imaging & Media Lab (IML) Basel;
Nationale Informationsstelle für Kulturgüter Erhaltung (NIKE)
und Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (GSK )
Im Weiteren verweisen wir auf die Eingaben des Vereins Schweizerischer Archivarinnen und Archivare (VSA), des Verbandes der Museen der Schweiz (VMS) sowie des Verbandes der Bibliotheken und Bibliothekarinnen/Bibliothekare der Schweiz (BBS).
Wir schicken voraus, dass der Bericht enttäuscht und wir die getroffenen Feststellungen und Schussfolgerungen nicht unterstützen. Zusammenfassend halten wir fest, dass der Bericht
- eine transparente Situierung seines Gegenstandes und der dazu seit dem Jahr 2000 geführten Diskussionen vermissen lässt;
- nichts Neues enthält, sondern bloss Bekanntes und Bestehendes bestätigt;
- entsprechend keine neuen Perspektiven aufzeigt, die geeignet wären, den sich stellenden Herausforderungen zu begegnen;
- die zu einzelnen Problemstellungen vorgetragenen Lösungsvorschläge nicht aufnimmt;
- eine sachlich wie politisch nicht gerechtfertigte Eingrenzung des Aufgabenbereichs des Bundes vorschlägt
- und dessen Schlussfolgerungen ungenügend und nicht hinreichend präzise sind.
Allgemeine Einschätzung
Das Vorwort zum Bericht gibt die Stossrichtung und Tonalität des Berichtes programmatisch vor: Die „Illusion“ einer umfassenden Regulierung der Memopolitik soll „zerstört“ werden, „Mut zur Lücke“ wird postuliert und schliesslich in der Einführung apodiktisch festgehalten, dass die „entscheidenden Fragen“ nicht beantwortet“ und „Lösungen nicht erarbeitet“ seien. Es folgt im zweiten Kapitel eine reichlich theoretische Abhandlung zum Begriff des „Gedächtnisses“, die uns wenig adressatengerecht scheint und mit den weiteren Überlegungen kaum in einem Bezug steht. Nicht im Interesse der Sache wird jedoch der Eindruck geweckt, dass die Bewahrung und Vermittlung ein der Beliebigkeit anheim gestellter Prozess sei. Positiv heben wir die Ausführungen im dritten Kapitel hervor, welche die mit der Digitalisierung einhergehenden Herausforderungen im Wesentlichen bezeichnet. Im Sinne der programmatischen Einleitung wird nun aber darauf verzichtet, bereits vorgetragene Lösungsvorschläge zu diskutieren. Ebenso wenig werden die mit der Digitalisierung einhergehenden Chancen thematisiert. Mit der Umschreibung der heutigen Rechtssituation auf Bundesebene wird im vierten Kapitel die zentrale Aussage des Berichtes untermauert, wonach sich die Memopolitik des Bundes auf den bestehenden Auftrag der Gedächtnisinstitutionen zu begrenzen habe. Perspektiven, die über das Bestehende hinausweisen und geeignet wären, die im dritten Kapitel aufgezeigten Herausforderungen anzugehen, fehlen. Im Gegensatz zum lückenhaften Kapitel 6, welches eine unvollständige Zusammenstellung der Initiativen von Kantonen, Städten, Privaten und Dritten liefert, werden im Kapitel 5 die Aktivitäten der Gedächtnisinstitutionen des Bundes umfassend beschrieben. Auch dies ist mit Blick auf die Hauptaussage – Konzentration auf den bestehenden Auftrag der Bundesinstitutionen – bezeichnend. Wir bedauern es, dass die Chance nicht genutzt wurde, eine Auslegeordnung der in der Gedächtnisbildung tätigen Institutionen vorzunehmen. Die Denkmalpflege wird ohne stichhaltige Begründung ausgeklammert (S.9), der Aufgabenbereich der Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege im Kapitel 5 dennoch beschrieben, wobei unterschlagen wird, dass das ISOS von einem privaten Büro erarbeitet wird (S.47). Es fällt ein durch die Bundesbrille stark eingetrübter Blick auf die Memolandschaft Schweiz auf.
Die Schlussfolgerungen und die Vorschläge zum weiteren Vorgehen stehen im Widerspruch zu den insbesondere in den Kapiteln 3 und 6 vorgetragenen Analysen: Die Notwendigkeit eines koordinierten und mit entsprechenden Kompetenzen und Mitteln hinterlegten Vorgehens wird zwar ausgewiesen, Massnahmen indes mit Verweis auf fehlende Finanzen sogleich abgelehnt. Ganz im Gegensatz zu den Anstrengungen der Forschungspolitik und ihrer Institutionen sowie der bundesrätlichen Strategie zur Informationsgesellschaft wird empfohlen, die Retrodigitalisierung zugunsten der Bewahrung des audiovisuellen Erbes der letzten Jahrzehnte zurückzufahren. Konkrete, kurz- und langfristige Massnahmen, die über den Status quo hinausweisen, fehlen gänzlich.
Der Bericht hinterlässt Ratlosigkeit: Er liest sich wie ein Requiem auf die von den Bundesinstitutionen im Jahre 2000 ergriffene Initiative für eine Memopolitik. Dieser Abgesang ist unseres Erachtens nicht gerechtfertigt und genügt nicht als Antwort auf die sich heute stellenden Herausforderungen, was uns zur Detailbesprechung führt.
1) Situierung und Kontextualisierung
Verdienstvoll und vorausschauend hat der damalige Direktor der Landesbibliothek im Jahre 2000 die Initiative zur Formulierung einer Memopolitik ergriffen. Bekanntlich sind zwischen den Protagonisten – dem Direktor des Bundesarchivs, dem Direktor der Landesbibliothek sowie dem Direktor von Memoriav – aus pragmatischen Gründen alsbald Differenzen aufgetreten: Aus nachvollziehbaren Gründen waren nicht alle Beteiligten gewillt, einen klaren gesetzlichen Auftrag gegen die unbekannten Ziele und Vorgaben eines noch zu etablierenden neuen Politikfeldes einzutauschen. Im Interesse einer transparenten Diskussion müssten die Gründe dargelegt werden, welche dazu geführt haben, „dass die Formulierung einer nationalen Memopolitik ohne Ergebnisse geblieben ist“ (S.8). Zweifellos ist die Begründung eines neuen Politikbereiches ein unsicheres und ambitiöses Unterfangen und vieles deutet darauf hin, dass sich diese Idee nicht innert der gebotenen Zeit realisieren lässt. Da der dritte Teil des beim IDHEAP in Auftrag gegebenen Berichtes noch aussteht, scheint uns die Verabschiedung dieses Projektes doch verfrüht zu sein. Zumindest müsste die behauptete Ergebnislosigkeit von einer kritischen Sichtung und Diskussion der in den vergangenen acht Jahren geleisteten Arbeit begleitet sein. Da mit den Arbeiten der Gruppe wie der Berichte des IDHEAP zumindest eine wichtige Sensibilisierungsarbeit geleistet und zahlreiche Anstösse gegeben wurden, können wir die negative Beurteilung dieser Anstrengung nicht teilen. Der nun postulierte Rückzug auf den bestehenden Sammlungsauftrag der grossen Gedächtnisinstitutionen des Bundes ist mit Bestimmtheit keine Lösung. Alternativen müssten aufgrund der bisher geleisteten Arbeiten aufgezeigt werden.
2) Bestätigung des Bestehenden – Rückzug auf den gesetzlichen Sammlungsauftrag
Damit sind wir bei der Hauptaussage des Berichtes: Die Gedächtnisinstitutionen des Bundes sollen sich, gestützt auf die ausreichenden, bestehenden Grundlagen auf die Bewahrung insbesondere digital erstellter Zeugnisse konzentrieren und beschränken. Unbestritten ist, dass dies getan werden muss, und dass die Rechtsgrundlagen dazu ausreichend sind; sie wurden durch den im Januar 2008 vom Bundesrat verabschiedeten „Aktionsplan zum Umgang mit elektronischen Daten und Dokumenten“ ergänzt. Die Wahrnehmung dieses gesetzlichen Auftrages ist jedoch nicht ausreichend (siehe Abschnitt 4) und soll nicht um den Preis eines Verzichtes auf die so genannte Retrodigitalisierung vorhandener Zeugnisse umgesetzt werden.
3) Konzentration auf digital erstellte Zeugnisse – Verzicht auf die so genannte Retrodigitalisierung
Positiv heben wir hervor, dass das BAK und die ihm zugeordneten Institutionen die Sicherung des audiovisuellen Kulturgutes mit Entschiedenheit an die Hand nehmen. Bereits in der Periode 2008 – 2011 wurden Memoriav deutlich mehr Mittel zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt, was wir durchaus begrüssen. Ob nun zusätzliche Mittel im beschriebenen Umfang notwendig sind, muss am Ende der laufenden Periode entschieden werden. Zahlen und Fakten zum Erreichten wie zum Geplanten sind erforderlich, werden indes nicht geliefert.
Der Verzicht auf die so genannte Retrodigitalisierung ist hingegen mit Entschiedenheit zurückzuweisen. Bereits der Begriff „Retrodigitalisierung“ suggeriert, dass die blosse Reproduktion historischer Druckwerke im Vordergrund stünde. Die Digitalisierung zielt indes darauf ab, nur schwer zugängliche Quellen zu erschliessen, oftmals gefährdete Dokumente digital zu sichern, verstreute Zeugnisse sachlogisch zu verknüpfen, kurz das Wissen sichtbar und verfügbar zu machen. Es geht also nicht um Retrodigitalisierung, sondern um die digitale Nutzbarmachung von Kulturgütern und Wissensbeständen. Mit der Ausblendung der digitalen Nutzbarmachung wird der Sinn und Zweck jeglicher Memopolitik verfehlt: die Wissensvermittlung. Wie der Bericht zeigt, kommen damit zentrale Zusammenhänge, die zugleich Lösungsoptionen und Chancen bieten, nicht in den Blick:
a) Der Ausschluss der digitalen Vermittlung und Verknüpfung löst den für die Memopolitik selbstverständlichen und bedeutenden Bezug zur Wissenschafts- und Forschungspolitik auf: Angesichts des gegenwärtigen europaweiten Aufbaus von Forschungsinfrastrukturen für digitale Ressourcen sowie entsprechenden Initiativen in der Schweiz ist der Rückzug auf den Sammlungsauftrag der Bundesinstitutionen nicht nachvollziehbar. Vielmehr müssen die Initiativen der Forschungsgemeinschaft mit jenen der Bundesinstitutionen eng verzahnt werden, wie dies etwa im Rahmen der Edition der Diplomatischen Dokumente der Schweiz (DDS) bereits seit Jahren erfolgreich praktiziert wird.
b) Der Ausschluss der Vermittlungsfrage ist für die Schweiz insgesamt und die auf die Schweiz bezogene Forschung im besonderen von grösstem Nachteil, da damit deren internationale Zugänglichkeit und Sichtbarkeit erschwert wird: Zunehmend wird nur noch wahrgenommen, was im Netz ist. Diese Herausforderungen müssen die ‚sammelnden’ Institutionen mit den hauptsächlichen Vermittlern, den Forschenden, gemeinsam angehen.
c) Schliesslich ist festzuhalten, dass eine Memopolitik grundsätzlich alle relevanten Zeugnisse der Vergangenheit unabhängig von ihren Datenträgern umfassen muss. Überdies birgt die Konzentration auf digital erstellte Zeugnisse die Gefahr einer Überbewertung des ohnehin leichter zugänglichen Materials und der Dokumente der Zeitgeschichte in sich.
4) Eine pluralistische Überlieferung erfordert Koordination
Korrekterweise hält der Bericht fest, dass die Überlieferung in einem föderalistischen Staatswesen pluralistisch erfolgt und dies insofern nicht nachteilig ist, als die Vielfalt gewahrt bleibt und überdies ‚Doppelspurigkeiten’ auch gewisse Sicherungsfunktionen erfüllen. Doppelspurigkeiten sind überdies im Archiv- und Bibliotheksbereich im Unterschied zum Museumsbereich kaum problematisch. Festzuhalten ist auch, dass die im Bericht immer wieder beschworene Zunahme der zu bewahrenden Zeugnisse primär im Zusammenhang mit der Dokumentation des 20. Jahrhunderts problematisch ist. So kann und soll die Sammlung – möglicherweise mit Ausnahme des Museumsbereichs – der Zeugnisse gemäss dem gesetzlichen Auftrag der einzelnen Institutionen erfolgen.
Die Erschliessung und Vermittlung sowie die Langzeitsicherung erfordert hingegen eine Koordination unter allen beteiligten und interessierten Institutionen. Dieser Aufgabe wollen sich nun offensichtlich die Bundesinstitutionen nicht stellen. Diese Haltung steht jedoch im Widerspruch zu den Aussagen im Bericht selbst sowie zu den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen: Die geltenden wie die im Entwurf vorliegenden Gesetze für das Nationalmuseum, die Nationalbibliothek wie das Bundesarchiv halten fest, dass letztere die weiteren Institutionen in ihrem Bereich fachlich unterstützen, Dienstleistungen erbringen und sich insbesondere für die Koordination einsetzen. Diese Aufgaben sind indes als Ziele formuliert und nicht mit den entsprechenden Kompetenzen hinterlegt. Obwohl der Bericht diesen Führungs- und Koordinationsanspruch der genannten Bundesinstitutionen verschiedentlich hervorhebt , wird mit Verweis auf die Mittelknappheit sowie die kantonalen Zuständigkeiten das Gegenteil postuliert. Wir sind hingegen dezidiert der Meinung, dass die Erschliessung und Vermittlung zwingend koordiniert werden muss, da nur unter dieser Voraussetzung das den digitalen Medien inhärente Vernetzungspotenzial zum Tragen kommt. Wir halten auch fest, dass entgegen den Aussagen im Bericht, einem solchen Engagement rechtlich nichts entgegensteht, sofern der politische Wille dazu bei allen Betroffenen vorhanden ist.
5) Lösungswege und Schlussbetrachtung
Wir erachten es nicht nur als wünschenswert, sondern auch als möglich, dass in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen den führenden Bundesinstitutionen, den Kantonen, den Städten sowie den namentlich aus Wissenschaft und Forschung hervorgegangenen Initiativen eine effektive Koordination der Erschliessung und Vermittlung realisiert werden kann. Dabei sind verschiedene Modelle denkbar, die sich auch kombinieren liessen und die sich ohne Gewichtung wie folgt auflisten lassen:
a) Wie im Bildungsbereich mit Erfolg demonstriert, kann auch in der Memopolitik der Weg der interkantonalen Zusammenarbeit beschritten werden. Als Partner bieten sich die Konferenz der Kantonsregierungen an bzw. die Konferenz der Kulturbeauftragten der Kantone und Städte.
b) Eine Schlüsselstellung kommt unseres Erachtens den Fachverbänden zu. Letztere bedürften dazu zwar auch finanzieller Mittel, jedoch in erster Linie der notwendigen Kompetenzen. Die Mandatierung der Verbände mit hoheitlichen Aufgaben wurde in der Schweiz wiederholt und mit Erfolg in all jenen Fällen gewählt, wo eine föderalistische Kompetenzordnung eine zentralistische Lösung ausschloss. Die zuständigen Verbände haben bekanntlich in zahlreichen Arbeitsgruppen etwa in Form von Thesauri und Erschliessungsmitteln wertvolle Vorarbeit geleistet. Ihnen fehlt indes die Kompetenz, diese Standards auch durchzusetzen, bzw. über die Erarbeitung von „best practices“ Anreize für gesamtschweizerische Lösungen zu schaffen.
c) Wirksam ist auch die Schaffung von Konsortien, welche die interessierten Institutionen der verschiedenen Staatsebenen sowie Dritte und Private zweckspezifisch einbinden. Exemplarisch sei auf das äusserst effektive und schlanke Konsortium „Elektronische Bibliothek Schweiz“ verwiesen.
d) Potenziale bieten die Initiativen von Wissenschaft und Forschung: Im Rahmen von Quelleneditionen, Enzyklopädien sowie Datenbanken kann die Zusammenarbeit bereichsspezifisch vorangetrieben werden.
e) Schliesslich ist besonders im Bereich der Langzeitarchivierung an den Aufbau eines nationalen Kompetenzzentrums zu denken, wobei die Errichtung eines „dark archiv“ besonders dringlich ist.
Die nun offensichtlich von den vier beteiligten Bundesinstitutionen als gescheitert erachtete Memopolitik im umfassenden Sinne (siehe Kapitel 1) ist kein Anlass für einen gänzlichen Verzicht auf ein national koordiniertes Vorgehen. Dies umso weniger als die Bundesinstitutionen bei diesem Unterfangen weitgehend unter sich geblieben sind. Gefragt ist nun vielmehr die Öffnung gegenüber all jenen Partnern in Kantonen, Städten, Gemeinden, Forschung und Wissenschaft, die wiederholt ihr Interesse und ihre Kompetenzen manifestiert haben, um pragmatische Lösungen auszuarbeiten. Abschliessend halten wir fest, dass der Rückzug der Bundesinstitutionen auf ihren Sammlungsauftrag keine Antwort auf die sich stellenden Herausforderungen sein kann, sicher den Titel Memopolitik des Bundes nicht verdient und sich diese Strategie auch im internationalen Vergleich seltsam ausnimmt: Der Rückzug der Gedächtnisinstitutionen in ein kulturelles Réduit ist keine Antwort auf die internationale Vernetzung der Wissensbestände und nicht nur für den Forschungsstandort Schweiz, sondern für die Reputation der Schweiz insgesamt schädlich. Auch unter Verzicht auf eine gesamtschweizerische Regulation der Erinnerungsbildung, wie diese im Rahmen des Projektes Memopolitik angedacht wurde, lassen sich Fortschritte erzielen. Dies verlangt jedoch eine Öffnung hin zu den interessierten Partnern, so dass die durchaus vorhandenen Lösungsvorschläge gemeinsam geprüft und umgesetzt werden.
Wir danken Ihnen, sehr geehrter Herr Amrein, für Ihre Aufmerksamkeit, und wir verbleiben
mit freundlichen Grüssen
Frau Prof. Anne-Claude Berthoud
Präsidentin SAGW
Herr Dr. Markus Zürcher
Generalsekretär SAGW