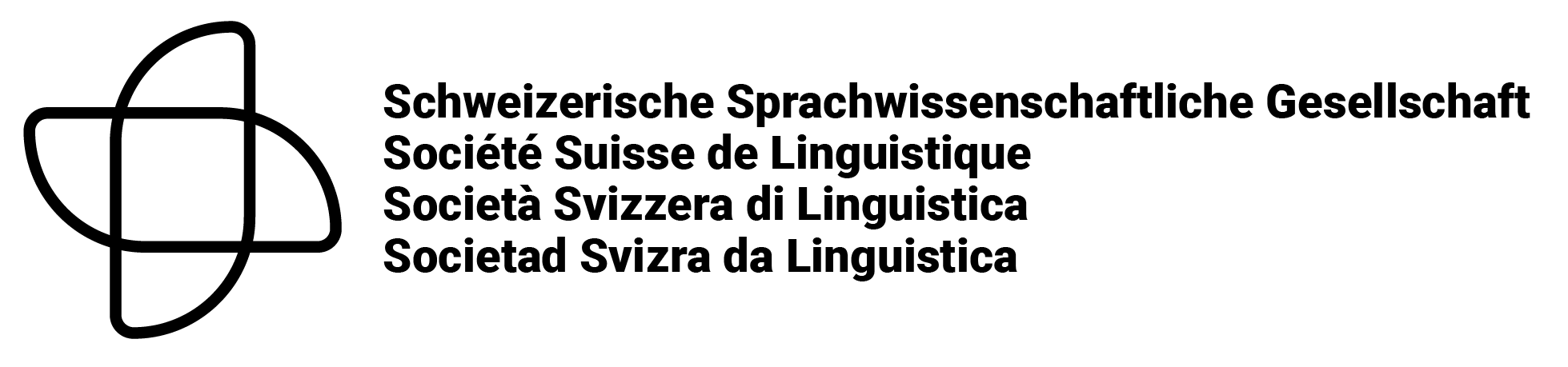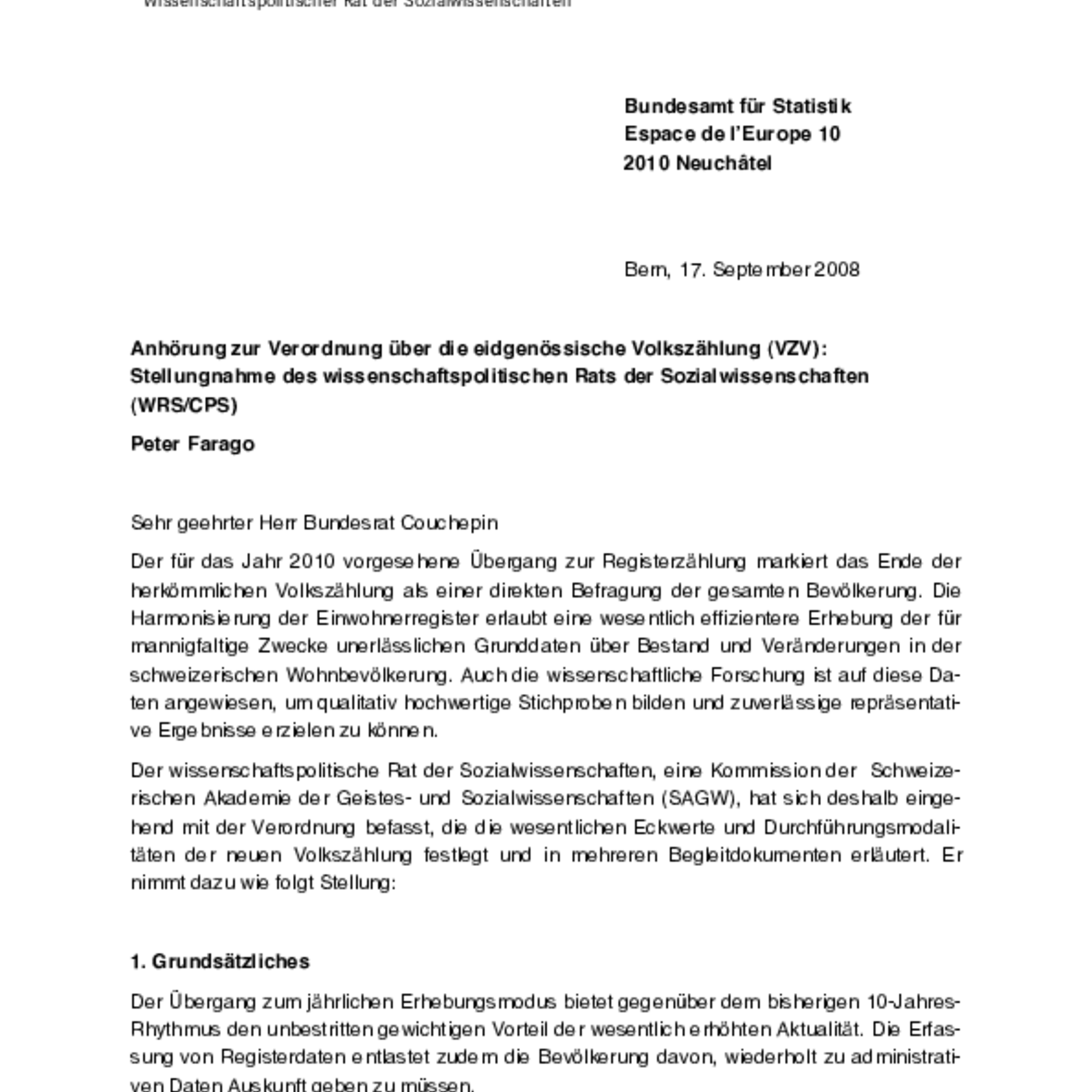Bundesamt für Statistik
Espace de l’Europe 10
2010 Neuchâtel
Bern, 17. September 2008
Anhörung zur Verordnung über die eidgenössische Volkszählung (VZV):
Stellungnahme des wissenschaftspolitischen Rats der Sozialwissenschaften (WRS/CPS)
Sehr geehrter Herr Bundesrat Couchepin
Der für das Jahr 2010 vorgesehene Übergang zur Registerzählung markiert das Ende der herkömmlichen Volkszählung als einer direkten Befragung der gesamten Bevölkerung. Die Harmonisierung der Einwohnerregister erlaubt eine wesentlich effizientere Erhebung der für mannigfaltige Zwecke unerlässlichen Grunddaten über Bestand und Veränderungen in der schweizerischen Wohnbevölkerung. Auch die wissenschaftliche Forschung ist auf diese Da-ten angewiesen, um qualitativ hochwertige Stichproben bilden und zuverlässige repräsentative Ergebnisse erzielen zu können.
Der wissenschaftspolitische Rat der Sozialwissenschaften, eine Kommission der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW), hat sich deshalb eingehend mit der Verordnung befasst, die die wesentlichen Eckwerte und Durchführungsmodalitäten der neuen Volkszählung festlegt und in mehreren Begleitdokumenten erläutert. Er nimmt dazu wie folgt Stellung:
1. Grundsätzliches
Der Übergang zum jährlichen Erhebungsmodus bietet gegenüber dem bisherigen 10-Jahres-Rhythmus den unbestritten gewichtigen Vorteil der wesentlich erhöhten Aktualität. Die Erfassung von Registerdaten entlastet zudem die Bevölkerung davon, wiederholt zu administrativen Daten Auskunft geben zu müssen.
Allerdings haben der WRS und die SAGW schon frühzeitig darauf hingewiesen, dass die Registerdaten allein für wissenschaftliche Zwecke keine hinreichende Grundlage bilden, weil in den Registern zahlreiche für die Forschung wichtige Basisinformationen fehlen. Auf diesem Hintergrund ist es zu begrüssen, dass neben der Registererhebung weitere Befragungen stattfinden, die die thematischen Lücken auffüllen sollen. Dabei spielt die schriftliche Strukturerhebung dank ihrer grossen Stichprobe (200'000) bei der jährlichen Durchführung und der obligatorischen Auskunftspflicht eine zentrale Rolle.
Zusammen mit einer Reihe periodisch wiederholter thematischer Repräsentativbefragungen bilden Register- und Strukturerhebung ein Erhebungsprogramm, das mit dem traditionellen, jetzt aber nicht mehr zutreffenden Namen „Volkszählung“ bezeichnet wird (in der Einzahl, obwohl es sich um mehr als ein halbes Dutzend unterschiedlicher Erhebungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten handelt). Dieses Erhebungsprogramm soll das „Rückgrat eines neuen Gesamtsystems für Haushalts- und Personenstatistiken“ darstellen.
Die Neugestaltung der Volkszählung bedingt auf Seite des verantwortlichen Amtes und der zuständigen Facheinheiten ein grosses und konstantes Engagement zur Qualitätssicherung. Die systematische Berücksichtigung von Daten aus den Einwohnerregistern sowie dem Gebäude- und Wohnungsregister ist – zusammen mit der grossen Stichprobe der Strukturerhebung – für raumbezogene Analysen von erheblicher Bedeutung. Unerlässlich ist die konse-quente Umsetzung der vorgesehenen Elemente zur Integration der verschiedenen Erhebungen, darunter vor allem die „Schlüsselmerkmale“, die als „minimaler gemeinsamer Nenner“ und „harmonisiert“ in allen Erhebungen enthalten sein sollen. Gelänge dies nicht, so bliebe das „Erhebungsprogramm“ ein uneingelöstes Versprechen, die Volkszählung in ihrer neuen Form aus wissenschaftlicher Sicht alles in allem eher ein Rück- als ein Fortschritt.
2. Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Statistik und wissenschaftlicher Forschung
Mit dem Mandat des Staatssekretariates für Bildung und Forschung an die Stiftung FORS, in Kooperation mit dem BFS den Zugang zu wichtigen Datenbanken für sozialwissenschaftlich Forschende zu vereinheitlichen und so weit wie möglich zu vereinfachen, tritt die Zusam-menarbeit zwischen öffentlicher Statistik und wissenschaftlicher Forschung in eine neue Phase. Die SAGW, die zusammen mit dem Nationalfonds massgeblich an der Vorbereitung dieses Mandates beteiligt war, begrüsst alle Schritte, die zu seiner Umsetzung beitragen.
In dieser Hinsicht von besonderem Interesse ist das neue Instrument der „Omnibus-Erhebungen“ (Art. 13 VZV), das es für „interessierte Kreise“ möglich machen soll, „mit spezifischen Fragen bei der Befragung ‚aufzuspringen’“ (Erläuternder Bericht, S. 6). Dass dabei auch und gerade an die wissenschaftliche Forschung gedacht wird, geht zwar nicht aus den Vernehmlassungsunterlagen hervor, wohl aber aus dem Papier „Leistungen des BFS für Wissenschaft und Forschung“ vom August 2008, das von der BFS-Internetseite herunter geladen werden kann (hier: S. 4, Punkt 2.5).
Leider enthalten die verfügbaren Unterlagen nur wenige und in einer wichtigen Hinsicht wi-dersprüchliche Informationen zum „Omnibus“. Das „Erhebungsprogramm“, das 11 Seiten und damit einen Drittel seines Umfangs den thematischen Stichprobenerhebungen widmet, schweigt sich über den „Omnibus“ weitgehend aus. Insbesondere wird nichts über mögliche Themen und über mögliche Teilnahmekonditionen gesagt. Während aber das erwähnte Papier vom August 2008 in dieser Hinsicht davon spricht, die Forschenden könnten „die zu erhebenden Inhalte – innerhalb der Rahmenbedingungen der öffentlichen Statistik – mit-bestimmen“ und „innovative Steuerungsmodelle“ und „geeignete vertragliche Lösungen“ in Aussicht stellt (S. 4), bestimmt die VZV unmissverständlich: „Die Themen der Omnibus-Erhebungen werden durch das BFS festgelegt. Dritte können zusätzliche Erhebungsthemen und Erhebungsfragen beantragen. Sie tragen die Kosten der Erweiterung.“ (Art. 13 Abs. 2).
Im „Omnibus“ sollen 3000 Personen befragt werden, was im Vergleich mit den anderen Elementen der renovierten Volkszählung wenig ist.
Unklar ist die Periodizität: Während in den Vernehmlassungsunterlagen verschiedentlich auf jährliche Erhebungen verwiesen wird (s. Abbildung 1 und Tabelle 10 des „Erhebungsprogramms“) und im Papier vom August 2008 „die Einführung eines jährlichen ‚Omnibus’“ in Aussicht gestellt wird (S. 2), legt der Anhang der VZV eine Periodizität „nach Bedarf“ fest (S. 19), was im „Erhebungsprogramm“ bestätigt wird (S. 32).
Offenbar soll also der „Omnibus“ unregelmässig, mit einer relativ kleinen Stichprobe und ohne nähere vorgängige thematische Festlegungen durchgeführt werden.
Die Idee einer wissenschaftlichen Mehrthemenbefragung, die zu relativ günstigen Konditionen Daten guter Qualität liefern kann, ist es sicher wert, weiterverfolgt zu werden. Der gemäss Vernehmlassungsunterlagen vergleichsweise embryonale und im Detail wenig konsistente Entwicklungsstand dieses Instrumentes deutet jedoch darauf hin, dass ihm bislang nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt worden ist.
Aus Sicht der Wissenschaft ist das eine Lücke, die nachdrücklich und nachhaltig zu schliessen ist. Eine Zusammenarbeit mit wissenschaftsnahen Einrichtungen wie z.B. FORS sowohl in der Konzeptions- wie in der Implementationsphase des „Omnibus“ dürfte zu einer erhöhten Akzeptanz und damit auch intensiverer Nutzung des Instruments in Zukunft führen.
Unabhängig von der Weiterentwicklung des „Omnibus“ gilt es festzuhalten, dass das Erhebungsprogramm der Volkszählung spezifisch wissenschaftliche Bedürfnisse in zweierlei Hinsicht bis auf weiteres nicht wird abdecken können: die Erhebung von Meinungen, Werthal-tungen und berichtetem Verhalten sowie die Erfassung sozialer Dynamiken im zeitlichen Längsschnitt auf der individuellen Ebene. Auch die neue Volkszählung bleibt im wesentlichen auf die Erhebung so genannt „objektiver“ Daten, also individueller Merkmale und Eigenschaften fokussiert; und wie seit eh und je sind die Volkszählungserhebungen Querschnitte in e-nem jeweils klar definierten Zeitpunkt.
Die wissenschaftliche Forschung bleibt deshalb weiterhin auf Erhebungen wie das Schweizer Haushalt-Panel und den European Social Survey angewiesen. Die institutionelle Konzentration dieser und vergleichbarer Erhebungen bei FORS, das in engem Kontakt mit den sozialwissenschaftlichen Fachgesellschaften der SAGW steht, und der erwähnte Auftrag des Bundes zur gezielten Kooperation zwischen FORS und BFS können gewährleisten, dass wie schon bisher Inkompatibilitäten und Doppelspurigkeiten vermieden werden.
3. Die Position des WRS
1. Das Erhebungsprogramm der erneuerten Volkszählung ist aus wissenschaftlicher Sicht wertvoll, wenn und insoweit die Harmonisierung der verschiedenen Erhebungen zuverlässig gelingt.
Der mit der Registerzählung ermöglichte jährliche Erhebungsmodus bei der Volkszälung ist im Sinne erhöhter Aktualität und Nützlichkeit der Daten grundsätzlich zu begrüssen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist insbesondere die Strukturerhebung von hohem Wert, da sie es erlaubt, die Registerdaten mit dringend benötigten sozialwissenschaftlich relevanten Daten zu ergänzen, was unter anderem für raumbezogene Analysen bedeutsam ist. Das setzt voraus, dass die in den Vernehmlassungsunterlagen angekündigte Harmonisierung mittels einheitlich definierter Schlüsselmerkmale ohne Einschränkungen umgesetzt wird. Geschieht oder gelingt dies nicht, so ist der wissenschaftliche Nutzen der neuen Volkszählung stark eingeschränkt.
2. Der Vorschlag einer wissenschaftsorientierten Mehrthemenbefragung („Omnibus“) ist in Kooperation des BFS mit wissenschaftsnahen Kreisen zu konkretisieren und umzusetzen.
Die Idee, der wissenschaftlichen Forschung eine qualitativ hochwertige, nicht-kommerzielle Mehrthemenbefragung („Omnibus“) anzubieten, wird vom WRS unterstützt. Einzelheiten der Konzeption (z.B. thematisches Spektrum, Periodizität, Stichprobe) und der Umsetzung (z.B. Kontakt mit den Forscherteams, Bereinigung der Themen- und Fragekataloge) sowie der Modalitäten (z.B. Ausschreibung und Entscheid über Vergabe von Themenmodulen bzw. Frageblöcken) müssen noch präzisiert werden. Der Rat schlägt vor, die bereits institutionali-sierte Zusammenarbeit von FORS und BFS auf diese und verwandte Fragen auszudehnen.
3. Regelmässige wissenschaftliche Grosserhebungen stellen zusätzliche für die Forschung dringend benötigte Daten zur Verfügung; sie sind deshalb weiterhin unerlässlich.
Sowohl das Erhebungsprogramm der erneuerten Volkszählung wie auch das vom BFS intendierte „Gesamtsystem für Haushalts- und Personenstatistiken“ können die Bedürfnisse der wissenschaftlichen Forschung auf dem Gebiet der Grunddaten gesellschaftlicher Entwicklung nicht vollumfänglich abdecken. Subjektive Daten (Meinungen, Werte, berichtetes Verhalten) sowie Längsschnitterhebungen auf Haushaltebene (Haushalt-Panel) spielen, sofern sie vom BFS überhaupt vorgesehen sind, bloss eine Nebenrolle. Erhebungen, die diese Themenbereiche abdecken und unter wissenschaftlicher Ägide mit einem ebenso rigorosen Qualitätsanspruch durchgeführt werden, sind deshalb weiterhin unerlässlich. Dazu zählen in erster Linie die Grosserhebungen, für die seit 2008 FORS verantwortlich zeichnet (z.B. Schweizer Haushalt-Panel, European Social Survey, MOSAiCH).
Zur Sicherung der Qualität dieser Erhebungen, die alle vom Schweizerischen Nationalfonds mit namhaften Beiträgen unterstützt werden, ist es von allergrösster Bedeutung, dass die Frage nach dem Zugang zur Adressbasis für hochwertige Stichproben, die nicht registrierte Telefonnummern einschliessen, gelöst wird. Der SNF hat FORS beauftragt, entsprechende Vorstösse beim BFS und allenfalls beim EDI zu machen. Der Rat begrüsst und unterstützt diese Initiative im Interesse einer auf internationalem Niveau konkurrenzfähigen wissenschaftlichen Forschung.
Wir danken Ihnen, sehr geehrter Herr Bundesrat Couchepin, für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und verbleiben
mit freundlichen Grüssen
Im Namen des WRS:
Dr. Beat Immenhauser
Sekretär des WRS / stv. Generalsekretär der SAGW