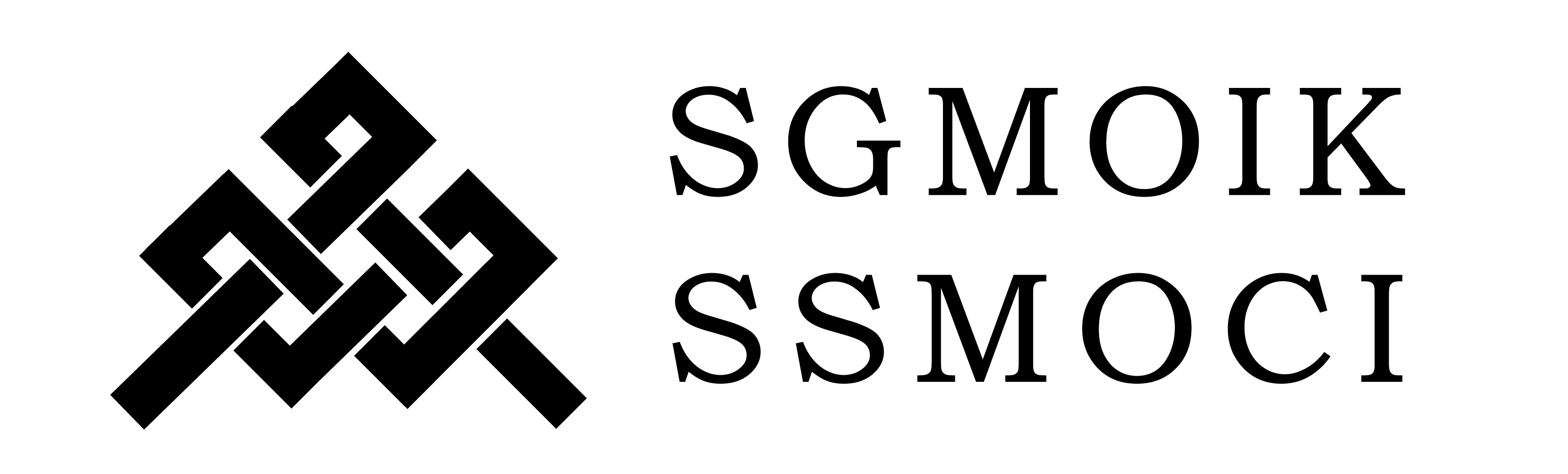Von Falestin Naïli und Valentina Napolitano
Es hagelt Drohungen gegen die ausgezehrte Bevölkerung von Gaza. Seit dem Ende der ersten Phase der fragilen Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel am 1. März sind die Verhandlungen über die zweite Phase in eine Sackgasse geraten. Israel hat am 2. März die Einfuhr von humanitärer Hilfe und Handelsgütern in das belagerte Gebiet erneut verboten. Seit Wochen signalisieren sowohl Israel als auch die USA, dass sie das verwüstete Gebiet als „Riviera“ neu gestalten wollen – ein Vorhaben, das eine erzwungene Umsiedlung von etwa zwei Millionen Palästinensern nach Jordanien und Ägypten bedeuten würde. Diese Menschen haben eine 15-monatige israelische Offensive überlebt, die von zahlreichen Menschenrechtsorganisationen als „Völkermord“ bezeichnet wird.
Währenddessen kehren Tausende Vertriebene in ihre Viertel zurück – oft mit nicht mehr als einem Zelt, das sie neben den Trümmern ihrer ehemaligen Häuser aufstellen. Denn in Gaza fehlt es an allem. Die israelischen Militäroperationen, die auf den Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 folgten, bei dem mehr als 1200 Israelis getötet und fast 250 als Geiseln genommen wurden, haben nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza über 48000 Menschen getötet und 111000 verletzt. 69 Prozent der Infrastruktur wurden beschädigt oder zerstört, darunter laut den Vereinten Nationen 245000 Wohnhäuser.
In dieser Katastrophe ist das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) von entscheidender Bedeutung – als grösste humanitäre Organisation für Gaza. Doch ihre Zukunft war noch nie so bedroht wie jetzt: sie steht zwischen einem israelischen Verbot in den besetzten Gebieten und der Entscheidung, ihre Finanzierung einzufrieren, von seiten der USA und der Schweiz.
Die Schweiz Zögert trotz humanitärer Katastrophe
Die Schweiz gehörte 2023 zu den zwölf grössten Gebern der UNRWA. Doch im Januar 2024 setzte sie ihre Unterstützung aus, nachdem Israel 19 der über 30000 UNRWA-Mitarbeitenden beschuldigt hatte, an den Angriffen vom 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Die Organisation reagierte umgehend: Sie identifizierte und entliess zehn Mitarbeitende, zwei weitere wurden als tot bestätigt. Mit der Unterbrechung der Unterstützung folgte die Schweiz dem Vorgehen mehrerer EU-Länder und der USA.
Während die meisten Geber nach einer Untersuchung unter der Leitung der ehemaligen französischen Aussenministerin Catherine Colonna ihre Zahlungen wieder aufnahmen – der Bericht attestierte der UNRWA „mehr Mechanismen zur Wahrung der Neutralität als anderen UN-Organisationen“ – halten die USA und die Schweiz ihre Mittel weiterhin zurück.
Die endgültige Entscheidung über den Schweizer Beitrag bleibt trotz monatelanger Debatten zwischen Parlament und Regierung aus. Am 18. Februar 2025 stimmte der aussenpolitische Ausschuss des Ständerats mit sehr knapper Mehrheit dafür, die Aussetzung der Finanzierung beizubehalten – ein Vorschlag des SVP-Politikers David Zuberbühler. Nun liegt es am Senat, in der Frühjahrssession vom 26. Februar bis 15. März zu entscheiden.
Unterdessen warnte die Schweizerische Gesellschaft der Anwält:innen für Palästina in einem Brief an die Mitglieder des Ausschusses vor den Folgen einer Einstellung der UNRWA-Unterstützung: Die Schweiz riskiere, sich „zur Komplizin eines Völkermords“ zu machen. Eine ähnliche Warnung hatte bereits das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) im Februar 2024 in einem internen Dokument ausgesprochen: Die Einstellung der Finanzierung könnte eine „potenzielle Verletzung der Genozid-Konvention“ bedeuten.
Israels Kampagne gegen die UNRWA
Während diese Debatten in der Schweiz andauern, führt die israelische Regierung eine dreifache Offensive gegen die UN-Agentur. Erstens werden ihre Infrastruktur und ihr Personal in Gaza ins Visier genommen. Seit dem 7. Oktober 2023 wurden 205 Schulen, Gesundheits- und Verteilungszentren bombardiert, 744 Vertriebene, die in UNRWA-Schulen Schutz suchten, sowie 273 Mitarbeiter der Agentur getötet. Diese Zerstörungen beschränken sich nicht mehr nur auf den Gazastreifen – auch Flüchtlingslager im Westjordanland wurden von der israelischen Armee angegriffen. Im Mai 2024 musste der Sitz der Agentur in Ost-Jerusalem schliessen, nachdem eine Gruppe israelischer Siedler versucht hatte, ihn in Brand zu setzen. Das Grundstück im Viertel Sheikh Jarrah, auf dem sich der Hauptsitz befindet, wurde zudem im Oktober 2024 im Zuge der Ausweitung einer israelischen Siedlung enteignet.
Zweitens begleitet eine Diskreditierungskampagne diese Angriffe: Israelische Regierungsvertreter bezeichnen die UNO-Agentur als „Terrororganisation“ und werfen ihr vor, mit der Hamas zu kooperieren. Jüngste Anschuldigungen, wonach eine israelische Geisel in einer UNRWA-Schule festgehalten worden sei, bezeichnete der UNRWA-Direktor Philippe Lazzarini als „zutiefst verstörend und schockierend“. Er betonte, dass die Agentur seit dem 13. Oktober 2023 aufgrund der israelischen Militäroffensive keine effektive Kontrolle mehr über ihre Einrichtungen in Gaza habe.
Schliesslich wurden auf rechtlicher Ebene am 28. Oktober vergangenen Jahres zwei umstrittene Gesetze von der Knesset verabschiedet, die ab Ende Januar 2025 die Aktivitäten der UNRWA in Ost-Jerusalem, im Westjordanland und im Gazastreifen verbieten. Das erste Gesetz, das im Oktober 2024 verabschiedet wurde, untersagt der Agentur jegliche Tätigkeit in israelischem Hoheitsgebiet, einschliesslich Ost-Jerusalems, das völkerrechtswidrig annektiert wurde. Das zweite Gesetz macht jeglichen Kontakt zwischen israelischen Staatsbehörden und der UNRWA illegal, wodurch jegliche Koordination zwischen der Agentur und der israelischen Militärverwaltung, die die besetzten Gebiete kontrolliert, verhindert würde. Dabei ist Israel als Besatzungsmacht gemäss den Genfer Konventionen von 1949 verpflichtet, den Zugang zu humanitärer Hilfe in diesen Gebieten zu gewährleisten.
Bereits am 4. November 2024 hatte Israel die Vereinten Nationen offiziell über seine Absicht informiert, seine Beziehungen zum UNRWA abzubrechen. Diese Entscheidung wurde einen Tag später durch den Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen bekräftigt, der Benyamin Netanyahu stets unterstützt und die UNO-Organisation seit seiner ersten Amtszeit scharf kritisiert hatte. Die Gesetze traten am 30. Januar in Kraft. An diesem Tag blieb das Hauptquartier der Agentur in Jerusalem zum ersten Mal geschlossen, obwohl sich zahlreiche Persönlichkeiten und Organisationen dagegen ausgesprochen hatten.
Parallel zu dieser Untergrabungskampagne erklärt Israel, es hoffe, dass andere UN-Agenturen und „unpolitische und effizientere“ internationale Organisationen die Aufgaben der UNRWA übernehmen werden. Doch das häufig als mögliche Alternativen genannte Internationale Komitee des Roten Kreuzes (ICRC) sowie Ärzte ohne Grenzen (MSF) haben eindeutig klargestellt, dass sie die UN-Agentur nicht ersetzen werden.
Tel Aviv befürwortet zudem den Einsatz privater Organisationen zur Verteilung humanitärer Hilfe in Gaza – ein Ansatz, der kaum mit den Prinzipien der Neutralität und Unabhängigkeit vereinbar ist. Durch die Förderung sogenannter „humanitärer Zonen“ oder „gated communities“, die unter der Aufsicht bewaffneter Kräfte stehen würden – möglicherweise sogar ehemaliger britischer Spezialeinheiten, wie The Guardian berichtet –, würde dieser Vorschlag den Gazastreifen faktisch in ein Internierungslager verwandeln.
Das Ende der Operationen der UN-Agentur, die in Gaza besonders aktiv ist – insbesondere bei der Polio-Impfung und der Koordination der vor der Waffenruhe nur spärlich eintreffenden Hilfe –, hätte dramatische humanitäre Folgen. Besonders in diesem belagerten Gebiet, in dem die Weltgesundheitsorganisation die gesundheitliche und humanitäre Lage als „katastrophal“ bezeichnet. Bereits im Januar 2024 hatte ein Beschluss des Internationalen Gerichtshofs (IGH) in diesem Zusammenhang auf das „Risiko eines Völkermords“ hingewiesen.
Im Westjordanland, wo seit Beginn des Jahres drei Flüchtlingslager von der israelischen Armee gewaltsam geräumt wurden, ist die Lage für die mehr als 40.000 Vertriebenen inzwischen ebenfalls kritisch.
Das drohende Ende des Rückkehrrechts
Über die derzeitige Situation hinaus verfolgt Israel mit dem Angriff auf die UNRWA ein politisches Ziel: die endgültige Auslöschung des Rückkehrrechts der palästinensischen Flüchtlinge. Der Angriff zielt darauf ab, diese Agentur loszuwerden, die in den 75 Jahren ihres Bestehens Israel unaufhörlich an seine Verantwortung für die Entstehung des Flüchtlingsproblems und die mit seiner Expansionspolitik verbundenen Verstöße gegen das Völkerrecht erinnert hat.
Während die Arbeit der UNRWA bei ihrer Gründung als neutral und unpolitisch gedacht war, hat sie sich zwangsläufig politisiert. Ursprünglich war es Aufgabe der UN-Konziliationskommission für Palästina (UNCCP), eine politische Lösung zur Beendigung des israelisch-palästinensischen Konflikts zu finden. Doch die Kommission stellte ihre Arbeit Ende der 1950er-Jahre ein. Seitdem ist die UNRWA die einzige UN-Organisation, die den Palästinensern staatenähnliche Dienstleistungen bereitstellt – allerdings ohne ihnen internationalen politischen Schutz zu gewähren.
Tatsächlich sind die Palästinenser vom Schutzsystem der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 ausgeschlossen. Die politische Dimension der UNRWA ergibt sich daraus, dass sie die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft für die palästinensischen Flüchtlinge sichtbar macht – eine Verantwortung, die diese selbst als Garantie für ihr Rückkehrrecht betrachten.
Theoretisch hätte das Mandat der UNRWA mit einer politischen Lösung enden können, wie sie beispielsweise von den Oslo-Abkommen 1993 erhofft wurde. Während der durch die Erklärung über Prinzipien zu Übergangsregelungen der Selbstverwaltung (Oslo I) eingeleiteten Verhandlungen wurden mehrere heikle Fragen – darunter auch das Flüchtlingsproblem – in die sogenannte „Endstatusphase“ verschoben, vorgeblich, um die Gesamtgespräche nicht zu gefährden.
Für die Palästinenser ging es bei diesen Verhandlungen nicht nur um das Rückkehrrecht der Flüchtlinge, sondern auch um die Schaffung eines palästinensischen Staates neben Israel innerhalb der Grenzen von 1967. Nach der Gründung eines solchen Staates hätte die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) die Aufgaben der UNRWA im Gazastreifen und im Westjordanland übernommen. Ein entsprechender Übergangsplan war im Programm zur Umsetzung des Friedens vorgesehen, um die Lebensbedingungen in den Flüchtlingslagern zu verbessern und die wirtschaftliche Entwicklung der palästinensischen Gebiete zu fördern.
Doch der Oslo-Prozess scheiterte, hauptsächlich aufgrund der fortgesetzten illegalen Siedlungspolitik Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten. Dies führte dazu, dass der völkerrechtliche Rahmen, der durch UN-Resolutionen festgelegt wurde, wieder an Bedeutung gewann – ein Punkt, den der Internationale Gerichtshof (IGH) in einer seiner jüngsten Entscheidungen betonte. Laut des IGH hat das Völkerrecht Vorrang vor politischen Verhandlungen, einschliesslich des Oslo-Abkommens.
Mit der Resolution der UN-Generalversammlung vom 18. September 2024, die Israel eine Frist von zwölf Monaten zum Rückzug aus den besetzten Gebieten setzte, erhielt das Völkerrecht neues Gewicht. Die bloße Existenz der UNRWA bleibt eine ständige Mahnung daran. Ihre Abschaffung würde Israel ermöglichen, das Flüchtlingsproblem endgültig von der politischen Tagesordnung zu verdrängen.
Während der Begriff „humanitäre Krise“ mittlerweile allgemein verwendet wird, um die katastrophale Lage im Gazastreifen zu beschreiben, zielen die beiden von der Knesset verabschiedeten Gesetze darauf ab, den wichtigsten Akteur, der dieser Krise begegnen könnte, auszuschalten. Nach der politischen Marginalisierung der palästinensischen Flüchtlingsrechte droht nun durch die gezielte Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen zunehmend die vollständige Auslöschung ihrer Existenz.
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz aus dem Französischen übersetzt. Er basiert auf einem Artikel, der am 7. November in The Conversation veröffentlicht wurde.
Valentina Napolitano ist Soziologin und Forschungsbeauftragte am Institut de recherche pour le développement (IRD). Sie ist Spezialistin für Migrationsfragen und Konflikte im Nahen Osten.
Falestin Naïli, ist Historikerin, Assistenzprofessorin an der Universität Basel und assoziierte Forscherin am Institut français du Proche-Orient. Sie ist Spezialistin für die Zeitgeschichte Palästinas und Jordaniens und leitet derzeit das SNF-Konsolidierungsprojekt „Futures Interrupted: social pluralism and political imaginairies beyond coloniality and the nation-state“.
Weiterführende Literatur
Al Husseini, Jalal, 2003, “L’UNRWA et les réfugiés : enjeux humanitaires, intérêts nationaux”, Revue d'études palestiniennes, N° 86(1), pp. 71-85, https://www.palquest.org/sites/default/files/LUNRWA_et_les_refugies_Enjeux_humanitaires_interets_nationaux.pdf
Bocco, Riccardo, 2009, “UNRWA and the Palestinian Refugees: A History within history”, Refugee Survey Quarterly, Vol. 28, Nos 2-3, pp. 229–252, https://academic.oup.com/rsq/article/28/2-3/229/1584825
Irfan, Anne, 2020, “Palestine at the UN: The PLO and UNRWA in the 1970s”, Journal of Palestine Studies, Vol. XLIX, No. 2 (Winter), pp. 26-47, https://www.palestine-studies.org/en/node/1649968
Jerusalem Quarterly, Issue 93-4, UNRWA Archives (Part 1-2), guest edited by Francesca Biancani & Maria Chiara Rioli
https://www.palestine-studies.org/en/node/1653824
https://www.palestine-studies.org/en/node/1654236