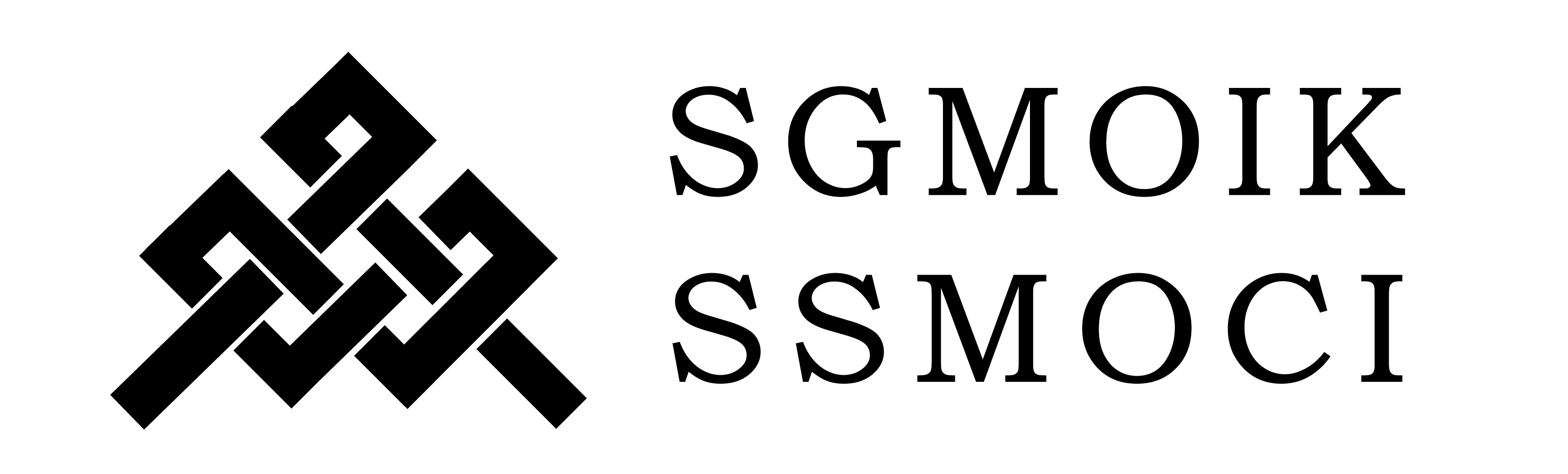Von Asmaa Dehbi und Noemi Trucco
«Wart nur ab, bis du grösser wirst, dann wirst du auch zum Kopftuch gezwungen!» – «Gehen Sie zurück in Ihr Land, Sie gehören nicht hierher.» – «Du hässlicher arabischer Bastard, geh nach Hause, um mit deinen parasitären faschistischen, untermenschlichen, palästinensischen Kameraden zu ficken, wir wollen euch nicht mehr in Europa haben, verschwindet.»
Die drei Aussagen stehen exemplarisch dafür, was Muslim:innen und muslimisch gelesene Menschen in der Schweiz immer wieder erleben. Die drei Betroffenen, die wir hier zitieren, haben uns ihre Erlebnisse im Rahmen einer Studie über antimuslimischen Rassismus erzählt, oder – im Falle des dritten Beispiels – in Form einer E-Mail vorgelegt.
Es handelt sich um die allererste Studie des Bundes zu antimuslimischem Rassismus. Das Schweizerische Zentrum für Islam und Gesellschaft (SZIG) hat sie im Auftrag der Fachstelle für Rassismusbekämpfung (FRB) erarbeitet. Für die Studie haben wir mit siebzehn Betroffenen gesprochen und rund 30 Expert:innen von Fachstellen, Behörden, muslimischen Organisationen und Universitäten befragt. Zudem haben wir über 200 wissenschaftliche Publikationen ausgewertet.
Das Ergebnis ist eindeutig: Erfahrungen von antimuslimischem Rassismus sind keine Einzelfälle. Antimuslimischer Rassismus ist erschreckend weit verbreitet und findet praktisch in jedem Alltags- und Lebensbereich statt.
Nur findet das Thema in der breiten Öffentlichkeit bisher kaum Beachtung. Selbst gravierende Taten gegen Muslim:innen erhalten wenig mediale Aufmerksamkeit. Sei es der Anschlag auf eine Moschee 2016 oder der antimuslimische Übergriff in Bad Ragaz 2024: Medien berichteten entweder gar nicht oder stellten die Verbrechen als Ausreisser dar.
Was ist mit antimuslimischem Rassismus gemeint?
Antimuslimischer Rassismus stellt «den Westen» und «den Islam» als gegensätzlich und unvereinbar dar. Das Muster ähnelt jenem von anderen Rassismusformen: Eine Bevölkerungsgruppe wird aufgrund ihrer vermeintlichen Kultur, Religion oder Herkunft als «anders» konstruiert, mit einer impliziten Hierarchie, die die «anderen» als rückständig, religiös-fanatisch, gewaltbereit, sexistisch oder demokratiefeindlich zeichnet. Die oben zitierte Hass-E-Mail zeigt sehr deutlich, wie Muslim:innen in diesem Prozess abgewertet und gar entmenschlicht werden.
Davon betroffen sind nicht nur Muslim:innen. Sondern auch Menschen, die aufgrund ihres Namens, ihrer Herkunft oder ihres Aussehens als muslimisch wahrgenommen werden, auch wenn sie nicht dem islamischen Glauben angehören.
Gleichzeitig sind nicht alle Muslim:innen gleich von Diskriminierung und Gewalt betroffen: Es trifft besonders jene, die als «eindeutig muslimisch» wahrgenommen werden – etwa, weil sie ein Kopftuch tragen oder lange Bärte. Vor allem das Kopftuch dient häufig als Anknüpfungsmöglichkeit für Rassismus und Diskriminierung: «Man weiss immer, was ich bin», sagte uns eine Befragte.
Die Entstehung von antimuslimischem Rassismus ist eng mit der europäischen Kolonialgeschichte verbunden. Die wichtigste Theorie dazu entwickelte der palästinensisch-amerikanische Literaturtheortiker Edward Said in den 1970er Jahren, in seinem richtungsweisenden Werk «Orientalismus»: Unter dem Begriff versteht Said den europäischen Blick auf Südwestasien und Nordafrika in Kunst, Literatur und Wissenschaft.
Orientalismus – und in der Folge antimuslimischer Rassismus – erfüllt zwei Funktionen: Er konstruiert den «Orient» als Vergleichsfolie für das Selbstbild Europas. Europa gilt dabei als fortschrittlich, demokratisch und geschlechtergerecht, während «der Orient» als rückschrittlich, antidemokratisch und geschlechterdiskriminierend gerahmt wird.
Dieses stereotype Bild wird auf Muslim:innen übertragen und dient als Legitimation für deren Diskriminierung. Man spricht ihnen ab, zur Mehrheitsgesellschaft zu gehören, und erschwert oder verhindert ihnen den Zugang zu gesellschaftlich relevanten Lebensbereichen.
Ein subtiles Beispiel findet sich in der Botschaft des Bundesrats zur Verhüllungsverbotsinitiative 2021. Dort schreibt der Bundesrat, dass die Gesichtsverschleierung die freie Wahl einer Person sein kann – zum Beispiel bei konvertierten Schweizerinnen. Dadurch, dass er die freie Wahl explizit Schweizer Konvertitinnen zuschreibt, stützt der Bundesrat implizit das oben beschriebene Bild: Alle anderen Musliminnen, die ein Kopftuch tragen, treffen also keine freie Wahl, sondern werden dazu gezwungen.
Das Beispiel zeigt, wie massenmediale und politische Debatten der Schweiz an kolonial geprägte Vorstellungen anknüpfen. Insbesondere die Debatten vor der Minarettverbotsinitiative 2009 haben stark dazu beigetragen, dass die Öffentlichkeit Muslim:innen als Problem sieht.
Diskussionen drehen sich häufiger um Muslim:innen – statt dass mit ihnen gesprochen würde. Schliesslich seien Muslim:innen, so das Bild, aussereuropäisch, fremd und entsprechend «die Anderen». Antimuslimischer Rassismus reiht sich damit ein in die verschiedenen «Überfremdungsnarrative», die in der Schweiz schon lange existieren: gegen Jüdinnen und Juden, Kommunist:innen und migrantische Arbeiter:innen.
Ein spezifisches Merkmal des antimuslimischen Rassismus ist, dass er häufig mit einem Bedrohungsnarrativ auftritt: Eine von der Eidgenössischen Kommission für Rassismus in Auftrag gegebene Studie belegt, dass 2017 jeder zweite Medienbeitrag zu Islam und Muslim:innen die Themen Radikalisierung und Terror behandelte. Das prägt das Bild von Muslim:innen als Sicherheitsrisiko. Entsprechend erzählt eine von uns befragte Person: «Ich werde oft als Terrorist beschimpft».
Muslim:innen stehen unter Generalverdacht, während für die Mehrheitsgesellschaft die Unschuldsvermutung gilt. Das Bedrohungsnarrativ dient als Legitimation, antimuslimischer Rassismus wird in der Folge normalisiert. Unterschwellig hält sich die Vorstellung, dass die Diskriminierung gegen Muslim:innen irgendwie berechtigt sei.
Es ist denn auch nicht überraschend, dass laut Bundesamt für Statistik fast 35% der Muslim:innen in der Schweiz angeben, rassistische Diskriminierung erlebt zu haben. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Alle von uns befragten Personen berichten, dass sie wiederholt und in unterschiedlichsten Alltagssituationen Rassismus erfahren haben. Dabei haben wir sie nicht spezifisch nach Lebensbereichen gefragt, sondern diese aus den aufgezeichneten und transkribierten Gesprächen herausgearbeitet.
Antimuslimischer Rassismus im Schweizer Bildungssystem
In Schulen, Kindergärten oder Universitäten scheint antimuslimischer Rassismus weit verbreitet zu sein. Alle von uns Befragten erzählten von rassistischen Situationen im Bildungssystem: In ihrer jetzigen Schul- oder Studiensituation, in ihrer Vergangenheit oder mit ihren Kindern. Umfassende Studien aber, die das Thema systematisch untersuchen, gibt es keine.
Dabei wäre eine solche Dokumentation dringend nötig – denn Rassismus im Bildungssystem ist hochproblematisch und kann für Betroffene weitreichende Konsequenzen haben. Zum Beispiel, wenn Lehrpersonen sie auf einem tieferen Leistungsniveau einstufen und weniger von ihnen erwarten als von anderen, und sie dementsprechend weniger fördern oder zu guten Leistungen anspornen. So erzählt uns ein Betroffener: «Der Lehrer hat gesagt, ‹Deutsch ist nicht Ihre Muttersprache. Wenn Sie mit einer Vier durchkommen, bin ich zufrieden.› Dann habe ich gesagt, ‹Aber ich nicht!›».
Solche Zuschreibungen bleiben nicht folgenlos. Sie wirken sich auf Laufbahnempfehlungen und Notenvergaben aus. Die Bildungssoziologie spricht hier vom sogenannten «Herkunftseffekt»: Wenn Lehrpersonen Entscheide unabhängig von der tatsächlichen Leistung treffen.
Zwar unterscheidet sich der tatsächliche Einfluss von Lehrpersonen auf Übertrittsempfehlungen von Kanton zu Kanton. Doch die Erfahrungen, von denen uns die Befragten und Expert:innen erzählten, ähneln sich kantonsübergreifend: Etwa, dass Muslim:innen und als muslimisch gelesenen Personen häufig ein Lehrberuf nahegelegt wird, obwohl deren Leistungen fürs Gymnasium ausreichen.
In den Erzählungen der Betroffenen findet sich oft auch «die eine Lehrperson», von der die eigene Schullaufbahn wesentlich abhing. Diese «eine Lehrperson» hat je nachdem den Bildungsaufstieg des oder der Betroffenen unterstützt – oder aber zu verhindern versucht. Eine Befragte erzählt von einer Lehrperson, die ihr gesagt habe: «Wenn ich will, kann ich dir mündlich eine schlechte Note geben, dann schaffst du es nicht».
Das schliesst an die Befunde verschiedener Studien an, die belegen, dass das Ideal der Chancengerechtigkeit im Schweizer Bildungssystem nicht ausreichend umgesetzt wird. Bildungschancen sind sozial ungleich verteilt, sie hängen noch immer von leistungsfremden Kriterien wie sozialer Herkunft, Migrationshintergrund oder Geschlecht ab. Auch Rassismus kommt hier zum Tragen.
Lehrpersonen schreiben muslimischen Schüler:innen zudem häufig unveränderliche und «in ihrer Kultur» verankerte Eigenschaften zu – und bedienen damit zum Beispiel das Bild, «der Islam» und Muslim:innen seien rückständig, patriarchal und antidemokratisch.
Lou, eine junge Muslimin, erzählte uns, wie eine Lehrperson reagierte, als sie in der Oberstufe das erste Mal mit einem Kopftuch zur Schule kam. Sie bat Lou nach draussen. Vor der Tür sagte sie ihr: «Ich habe dir einfach sagen wollen: So wirst du in deinem Leben nichts erreichen. Ich weiss nicht, was dein Vater dir erzählt hat, aber vielleicht kannst du es dir noch einmal überlegen (mit dem Kopftuch)».
Natürlich kennen wir den Beweggrund für diese Aussage nicht. Es könnte sein, dass die Lehrperson suggeriert, dass Lou ihren künftigen Erfolg in ihrer weiteren schulischen und beruflichen Laufbahn mit dem Tragen des Kopftuchs gefährdet. Oder sie befürchtet, dass Lou aufgrund des Kopftuchs zukünftig diskriminiert und deswegen keinen Erfolg haben wird.
Die erste Erklärung verweist stärker auf individuelle Vorurteile, die zweite wälzt eine strukturelle Diskriminierung auf das Individuum ab. In beiden Fällen aber ist die Aussage diskriminierend: Dadurch, dass die Lehrperson unterstellt, Lous Vater habe die Entscheidung für das Kopftuch beeinflusst, bedient sie das stereotype Bild patriarchaler Geschlechter- und Familienverhältnisse.
Antimuslimischer Rassismus am Arbeitsplatz
Auch auf dem Arbeitsmarkt berichten Betroffene von antimuslimischem Rassismus. Und auch hier hat Rassismus weitreichende Konsequenzen: Es beginnt mit der Schwierigkeit, überhaupt eine Arbeitsstelle zu finden, wenn es im Bewerbungsprozess zu ungerechtfertigten Benachteiligungen kommt. Rassismus kann sich in Mobbing am Arbeitsplatz manifestieren, in Lohndiskriminierung oder diskriminierenden Kündigungen.
Insbesondere Frauen mit Kopftuch erfahren immer wieder Diskriminierungen im Bewerbungsprozess: So konnte Nathalie Gasser von der Pädagogischen Hochschule Bern 2020 belegen, dass es für kopftuchtragende Frauen in der Schweiz auch mit ausgezeichneten Zeugnissen schwierig ist, eine Lehrstelle zu finden.
Dasselbe Muster findet man nicht nur bei Lehrstellen. Manche Apotheken, Spitäler, selbst einige Läden – wie ein publik gemachter Fall von Coop zeigt – legen in ihren Arbeitsverträgen fest, dass angestellte Frauen kein Kopftuch tragen dürfen. Der Kanton Genf kennt mit dem Laizitätsgesetz sogar ein Kopftuchverbot für Staatsangestellte. Wenn Frauen mit Kopftuch in der Schweiz keine Stelle finden, kommt es offenbar regelmässig vor, dass die Regionalen Arbeitsvermittlungen (RAV) sie auffordern, sich ohne Foto oder gar ohne ein Kopftuch zu bewerben. Dies berichtete uns eine Befragte, zeigt aber auch ein Artikel der UNIA-Gewerkschaftszeitung work vom 16. Juni 2023.
Das sind anschauliche Beispiele für intersektionale Diskriminierung. Intersektionalität heisst: Verschiedene Diskriminierungsformen überschneiden sich und wirken zusammen. Das Kopftuch verschränkt zwei Merkmale: Frau-Sein und Muslimisch-Sein. Die Verschränkung dieser beiden Merkmale bringt weitere Diskriminierungsformen mit sich. Denn: Es sind nur muslimische Frauen vom Kopftuchverbot betroffen.
Auch am Arbeitsplatz kommt es zu Zuschreibungen und Diskriminierungen. So wurde ein Betroffener, der im Gesundheitswesen arbeitet, von einem Patienten gefragt, ob er in seiner Heimat auch Besteck benutze. Solche Fragen mögen auf den ersten Blick unschuldig wirken. Doch viele Betroffene fühlen sich durch solches Othering abgewertet: «Diese Frage von ‹euch› und von ‹uns› ist immer: ‹Ja, du gehörst nicht dazu›», sagt ein Befragter.
Eine Betroffene, die ein Kopftuch trägt, wurde an ihrer alten Arbeitsstelle diskriminiert und entschied daraufhin, ein Mobbingverfahren einzuleiten und zu kündigen. Sie erzählt: «Sie haben mir ganz offen gesagt: ‹Du bist einfach gut›. Ich kann die Sprache gut, ich bin fachlich gut. ‹Wenn das nicht der Fall wäre, dann hättest du hier nichts zu suchen als jemand mit muslimischem Hintergrund›».
Antimuslimischer Rassismus im Gesundheitswesen
Im Gesundheitswesen empfinden viele Betroffene Diskriminierungserfahrungen als besonders schwerwiegend. Als Patient:in, egal ob bei einer Ärztin oder im Krankenhaus, befindet man sich in einer Situation, in der man verletzlicher ist als in anderen Lebenssituationen. Denn man ist abhängig von der Einschätzung und den Empfehlungen der Ärztinnen. Und es steht etwas Zentrales auf dem Spiel: die eigene Gesundheit. Das kann Diskriminierungserfahrungen verstärken.
Ärzt:innen und Psycholog:innen schreiben muslimischen Frauen oft Jungfräulichkeit oder patriarchale Familienverhältnisse zu. Äussern Musliminnen zum Beispiel gynäkologische Beschwerden, führen medizinische Fachpersonen diese mitunter auf eine «islamische» Zugehörigkeit zurück. Zum Beispiel, wenn Vaginismus, also die Verspannung und Verkrampfung des Beckenbodens und der Vaginalmuskulatur, mit vermeintlich konservativen Vorstellungen über Sexualität in Verbindung gebracht.
Dies kann dazu führen, dass Ärzt:innen Beschwerden nicht ernst nehmen, nicht nach medizinischen Ursachen suchen und die betroffenen Frauen dadurch nicht die notwendige medizinische Behandlung erhalten.
Auch im Hinblick auf das Schmerzempfinden gibt es im Schweizer Gesundheitswesen Zuschreibungen. Diese ähneln den Erfahrungen von Schwarzen Personen in den USA. Studien zeigen, dass Ärzt:innen ihnen häufig ein tieferes Schmerzempfinden unterstellen und deren Schmerzen in der Folge oft zu wenig behandelt werden.
Uns erzählte eine Betroffene: «Beim Zugang zur Gesundheitsversorgung muss man manchmal ein bisschen kämpfen. Weil es typischerweise Vorurteile gibt, dass muslimische Frauen sich mehr über Schmerzen und solche Dinge beschweren. Vor eineinhalb Jahren hatte ich eine Blinddarmentzündung. Und ich musste um Morphium kämpfen und plötzlich werde ich zum CT geschickt und da sehen sie, dass es überhaupt nicht in Ordnung ist, und dann sind sie es, die mir alle zwei Minuten Morphium geben».
Strukturen reflektieren, Wissen erweitern und geschützte Räume schaffen
Rassistische Diskriminierungen im Zusammenhang mit Schule, Arbeit und Gesundheitswesen, aber auch Behörden und Polizei sind keine Einzelfälle. Sie zeigen, dass antimuslimischer Rassismus systematisch in zentralen Lebensbereichen vorkommt.
Bildungseinrichtungen, Arbeitgebende, das Gesundheitssystem und öffentliche Institutionen tragen deshalb eine besondere Verantwortung, ihre eigenen Strukturen hinsichtlich antimuslimischen Rassismus zu reflektieren. Gerade an diesen Orten wäre es wichtig, dass Angehörige dieser Institutionen ihr Wissen über Rassismus erweitern und das Bewusstsein für eigene Verstrickungen in intersektionale, strukturelle Diskriminierungen schärfen.
Dazu sollten private wie auch öffentliche Institutionen rassismuskritische Bildungsangebote ausbauen und fest in ihren Alltag integrieren. Dazu braucht es neben präventiven Massnahmen auch Strategien zur Identifizierung und Intervention. Für Betroffene ist es entscheidend, dass sie sich sicher fühlen, ihre Erfahrungen, Unsicherheiten und Bedürfnisse frei äussern zu können. Besonders für Jugendliche sind «geschützte Räume» wichtig: Orte, an denen sie sich angesichts der zunehmenden Polarisierung der öffentlichen Debatten artikulieren und entfalten können.
*
Die vollständige Studie finden Sie hier: Trucco, Noemi, Dehbi, Asmaa, Dziri, Amir und Hansjörg Schmid (2025). Antimuslimischer Rassismus in der Schweiz: Grundlagenstudie. SZIG/CSIS-Studies 13. Freiburg: Schweizerisches Zentrum für Islam und Gesellschaft.
Asmaa Dehbi studierte Erziehungswissenschaften und Islam und Gesellschaft an den Universitäten Zürich und Fribourg. Sie ist Doktorandin und wissenschaftliche Assistentin am Schweizerischen Zentrum für Islam und Gesellschaft (SZIG) der Universität Fribourg mit den Arbeitsschwerpunkten Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft, sozialpädagogische Professionalität und antimuslimischer Rassismus.
Noemi Trucco studierte Soziologie und Middle Eastern Studies an den Universitäten Bern und Fribourg. Sie promovierte im Fach Soziologie zur Subjektivierung von Imamen und ist assoziierte Forschende am Schweizerischen Zentrum für Islam und Gesellschaft (SZIG) der Universität Fribourg. Ihre Schwerpunkte liegen in der Wissenssoziologie, Diskursanalyse und Subjektivierungsforschung. Sie beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit Muslim:innen und Islam in Europa, Prozessen des Othering und der Exklusion, Staatenlosigkeit, sozialen Konflikten und sozialer Ungleichheit.
Weiterführende Literatur
Bundesamt für Statistik (2020). Religiöse und spirituelle Praktiken und Glaubensformen in der Schweiz. Erste Ergebnisse der Erhebung zur Sprache, Religion und Kultur 2019. Neuchâtel: BFS.
Ettinger, Patrik (2018). Qualität der Berichterstattung über Muslime in der Schweiz. Bern: Eidgenössische Kommission gegen Rassismus EKR.
Gasser, Nathalie (2020). Islam, Gender, Intersektionalität. Bildungswege junger Frauen in der Schweiz. Bielefeld: transcript.
humanrights.ch und EKR (2024). Rassismusvorfälle aus der Beratungsarbeit 2023. Bericht zu rassistischer Diskriminierung in der Schweiz auf der Grundlage des Dokumentations-Systems Rassismus DoSyRa. Bern: humanrights.ch und EKR. https://www.network-racism.ch/rassismusberichte/rassismusvorfalle-in-der-beratungpraxis-2023