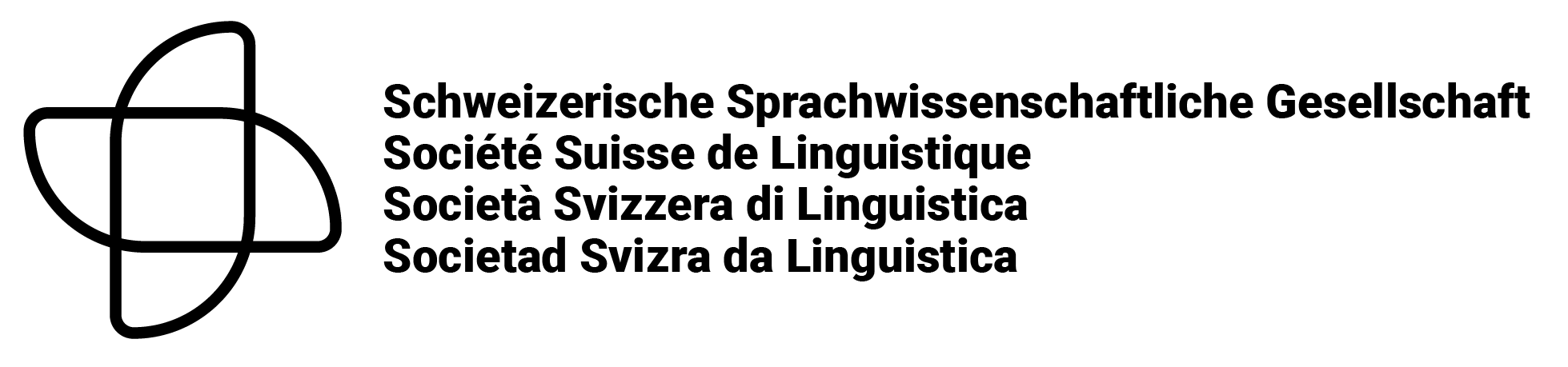Spätestens seit dem Frauenstreik 2019 werden in der Schweiz identitätspolitische Debatten sichtbar und laut, welche thematisch eine unterschiedliche Spezifik aufweisen, schliesslich aber auf dasselbe erinnerungskulturelle Desiderat hinweisen: das Nichtvorhandensein von Frauen, Menschen mit Migrationserfahrung und People of Color im öffentlichen Erinnerungsraum.
Zum einen wurde 2020 auch die Schweiz von der länderübergreifenden Black-Lives-Matter-Bewegung erfasst, in deren Kontext ein nationaler Diskurs über Denkmäler entbrannte. Bemängelt wurde von Teilen der Wissenschaft, Politik und Gesellschaft die heteronormative und hegemoniale Besetzung des öffentlichen Raumes durch in Bronze gegossene oder in Stein gemeisselte meist männliche, weisse Akteure, welche seit Jahrzehnten und Jahrhunderten für Schweizer Fortschritt, Innovation und Erfolg stehen. Dabei wird ausgeblendet, dass ihr Erfolg und Reichtum unter anderem auf der Ausbeutung von Indigenen (Johann August Sutter), der Haltung von Sklav:innen (Escher-Familie), respektive der Förderung des Sklav:innenhandels (David de Pury) fusst. Es wurden diverse Forderungen laut, solche Statuen aus dem öffentlichen Raum in Museen zu transferieren oder sie umzudeuten, sie mit der bislang unsichtbaren Geschichte zu ergänzen oder auf den Kopf zu stellen.
Zum andern stand das Jahr 2021 im Zeichen des 50-jährigen Frauenstimmrechts. Zahlreiche mediale Berichte und Artikel sowie wissenschaftliche Tagungen zogen Bilanz: «Schweizer Museen zeigen zu rund 70 Prozent Kunst von Männern. Ist eine Strasse nach einer prominenten Person benannt, ist diese in neun von zehn Fällen männlich. Frauen hingegen sind in den Geschichtsbüchern weitgehend inexistent.»[1]
Das Bedürfnis nach einer diverseren Erinnerungskultur ist evident. Aber wie lässt sich diese Vielstimmigkeit im Umgang mit den bereits bestehenden Denkmälern im öffentlichen Raum berücksichtigen?
Wer entscheidet? Und warum findet kein öffentlicher Diskurs statt?
Für bereits bestehende Denkmäler im öffentlichen Raum sind grundsätzlich die städtischen und kantonalen Stellen für Denkmalpflege verantwortlich – je nach Bedeutung des Objekts. Als Grundlage für ihre Arbeit dient ein öffentlich zugängliches Hinweisinventar mit den erhaltens- und schützenswerten Bauten und Anlagen. Welche Bauten und Anlagen einen Schutzstatus erhalten und somit offiziell Teil der Erinnerungskultur werden sollen, liegt demnach vorwiegend in der Kompetenz der Denkmalpfleger:innen; es findet kein öffentlicher Diskurs statt. Gegen eine grundeigentümerverbindliche Unterschutzstellung oder einen Abriss können die betroffenen Grundeigentümer:innen und einspracheberechtigten Verbände Rechtsmittel ergreifen. In diesem Fall müssen die öffentlichen Interessen gegeneinander abgewogen werden und es ist im Grundsatz möglich, eine erhaltenswerte Baute oder Anlage – und somit auch Denkmäler – zu Gunsten anderer öffentlicher Interessen zu entfernen. Dieser Prozess muss dokumentiert werden und wird durch die kantonale Genehmigungsinstanz geprüft.
Wie aber sieht die spezifische Rolle und Verantwortung der Denkmalpflege bei Denkmälern im öffentlichen Raum aus, die aufgrund ihrer Symbolik eine grössere politische Tragweite aufweisen? In der Stadt Zürich werden derzeit auf politischen Druck hin 26 Personendenkmäler durch die Arbeitsgruppe Kunst im öffentlichen Raum (KiöR) beziehungsweise «knapp 40 Denkmäler» von Historiker Georg Kreis überprüft. Diese Prüfung ist generell begrüssenswert, allerdings stellen sich viele Fragen: Wer sind in diesem Fall die Expert:innen, wer wird beratend dazu geholt? Und warum findet kein breit abgestützter öffentlicher Diskurs statt, obwohl es sich um eine höchst politische Frage handelt: Wie wollen wir als Gesellschaft erinnern?
Ausserdem: Welcher Handlungsspielraum besteht überhaupt? Eine Arbeitsgruppe kann lediglich Empfehlungen aussprechen zuhanden der Exekutive. Weiterhin einbezogen werden muss die Denkmalpflege bei einer Entfernung oder Veränderung eines Schutzobjektes.
Schon diese verkürzte Annäherung zeigt, dass aktuell vor allem der Schutz und das Bewahren von Denkmälern geregelt sind. Dies gilt selbst für neue Kunst im öffentlichen Raum, wie den Empfehlungen des Berufsverbands Visarte zu entnehmen ist: Sie wurden und werden für die Ewigkeit erstellt[2], ausser im Falle eines Schadens. Kann lediglich Aktivismus zu einer schnellen Entfernung führen, wie das Beispiel des 1989 mehrfach vom Sockel gestürzten Turnerdenkmals zeigt? Dieses und diverse weitere Beispiele von Vandalismus zur Entfernung von aus der Zeit gefallenen Denkmälern[3] legen den Finger auf die Wunde, lösen aber die heteronormative und hegemoniale Besetzung des öffentlichen Raumes höchstens punktuell. Denn wie die seit den 1970er-Jahren von Feminist:innen geforderte Umbenennung von Plätzen und Strassen zeigt, hat sich strukturell wenig getan: Den Forderungen wird bis heute viel zu selten nachgekommen.[4] Dabei sind ein öffentlicher Diskurs und Einbezug ebenso möglich wie sinnvoll. Viele Städte und Gemeinden haben in den letzten Jahren Erfahrungen mit Partizipationsprozessen gesammelt, ob mit Befragungen, Round Tables oder Workshops, spielend oder auf Spaziergängen, digital oder analog.[5] Wieso werden diese Verfahren nicht auch bei öffentlichen Denkmälern eingesetzt?
Was müssen wir neu denken? Oder verlernen?
An dieser Stelle lohnt sich ein Blick in die aktuelle Restitutionsdebatte, wo die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy und der Wirtschaftswissenschaftler Felwine Sarr mit beachtlichem Erfolg eine «Geste der Rückgabe» einfordern, die eine «neue Beziehungsethik zwischen den Staaten des globalen Nordens und denen des Südens»[6] einleiten könne. Sie eröffnen damit über die Museumskultur hinausreichende Handlungsoptionen. Eine «Geste der Entfernung» und / oder eine «Geste der Ergänzung» könnten ein ernstzunehmender Anfangspunkt für eine neue Denkmalkultur darstellen und zu einer neuen Beziehungsethik zwischen den über- und unterrepräsentierten Teilen unserer Gesellschaft beitragen: einem Gefühl von Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Dies würde voraussetzen, dass auch in der Geschichte «alles fliesst».[7] Ein solcher Geschichtsbegriff stellt in der Konsequenz die heute angenommene ewige Gültigkeit von Denkmälern in Frage.
Im Sinne einer zeitgemässen Denkmal- und Erinnerungskultur müssen sich Städte und Gemeinden proaktiv für eine neue Beziehungsethik im öffentlichen Raum einsetzen, um ihre Denkmäler nicht bloss zu schützen, sondern zu erneuern. Die vor kurzem erfolgte Ausschreibung der Stadt Neuchâtel zur Ergänzung der Statue de Purys oder die Projektgruppe RiöR (Rassismus im öffentlichen Raum) der Stadt Zürich zeigen, dass sich Schweizer Städte – wenn auch sehr zögerlich und noch viel zu sehr in ihren eigenen Strukturen gefangen – für eine neue Denkmalkultur zu interessieren beginnen. Bei einer Neu- oder Umgestaltung des öffentlichen Raums entscheiden jedoch in den meisten Fällen weiterhin Behördenmitglieder und Fachexpert:innen, wobei folgende These aufgestellt werden darf: Die Diversität unserer Gesellschaft in Bezug auf Geschlecht, Herkunft und Klasse ist dort nicht abgebildet, entsprechend bestimmen weiterhin einige wenige das kollektive Gedächtnis im öffentlichen Raum.
Eine zeigtmässe Denkmalkultur erfordert, dass bisherige Fachjurys Macht abgeben; es braucht mehr partizipative Strategien sowie allgemein mehr Transparenz bei diesen Prozessen.
Das heisst: Eine zeigemässe Denkmalkultur erfordert, dass bisherige Fachjurys Macht abgeben; es braucht mehr partizipative Strategien sowie allgemein mehr Transparenz bei diesen Prozessen. So wäre es endlich möglich, den öffentlichen Raum unserer Städte in der Gegenwart zu verankern und uns von einer falsch verstandenen Idee von «Erbe» zu verabschieden, das im ewigen Dienst des Erinnerns einer von der Vergangenheit hinterlassenen Ordnung steht.[8] Das Bestehende würde ergänzt durch Leistungen und Lebensrealitäten, die Teil unserer Gesellschaft sind, aber im öffentlichen Raum nicht erinnert werden und somit unsichtbar bleiben: FINTA* (Frauen, inter, nonbinary, trans, agender), People of Color, aber auch erinnerungspolitische Tabus wie (Zwangs)arbeiter:innen oder das Saisonnierstatut. Dafür muss die identitätspolitische Lobbyarbeit in den Hintergrund treten, um gemeinsam und solidarisch neue Formen von zeitgemässen Erinnerungspolitiken zu entwerfen. Voraussetzung für eine diverse und intersektionale Denkmal- und Erinnerungskultur wäre, dass diese «Anderen» politische, juristische, institutionelle und kulturelle Teilhabe erhalten.
Für alle, die einen Teil dazu beitragen wollen: Zentral ist der Akt des Sichtbarmachens. Dazu braucht es Grundlagenforschung. Aber auch Edit-a-Thons oder Hashtags wie #aufschrei, #metoo und #blacklivesmatter. Vielleicht sind dies Vorbilder einer zukünftigen Erinnerungskultur: Sie sind partizipativ und digital, ephemer und volatil.
Referenzen
[1] Andrea Kucera, Frauen erobern sich ihren Platz, NZZ am Sonntag, 10. Januar 2021, S. 10f.
[2] Visarte Berufsverband der visuell schaffenden Künstlerinnen und Künstler in der Schweiz. Wettbewerbsverordnung und Muster Werkvertrag. Visarte [21.11.2021].
[3] In Bristol wurde 2020 die Statuen von Edward Colston von einer wütenden Menge gestürzt und anschliessend permanent entfernt, in Bern wurden rassistische Teile eines Wandbilds im Wylergut übermalt, die Stadt Bern verzichtete auf eine Anzeige und eine Fachjury erteilte der Gruppe «Das Wandbild muss weg!» den Auftrag, das Wandbild gemäss ihrer Wettbewerbseingabe aus dem Schulhaus zu entfernen und in ein Berner Museum zu transferieren. In Neuchâtel wurde die Statue von De Pury 2020 mit roter Farbe bemalt, sie wurde wieder instand gesetzt, jedoch schrieb die Stadt ein Jahr später eine Ausschreibung zur Kontextualisierung des Denkmals aus.
[4] In Zürich zum Beispiel wäre es doch ein Leichtes gewesen, bei der Neugestaltung des Quartiers rund um den Hauptbahnhof (heute Europaallee), die dort entstehenden Strassen nach prominenten Frauen zu benennen.
[5] Zentrum öffentlicher Raum des Schweizerischen Städteverbands. Schwerpunkt Partizipation. Zentrum öffentlicher Raum (ZORA) | Schwerpunkte | Partizipation (zora-cep.ch) [21.11.2021].
[6] Felwine Sarr, Bénédicte Savoy: «Zurückgeben. Über die Restitution afrikanischer Kulturgüter». Berlin 2019.
[7] Landwehr Achim: Die Abwesenheit der Vergangenheit. Essay zur Geschichtstheorie. Frankfurt am Main 2016.
[8] Richard Drayton: Rhodes Must Not Fall? Statues, Postcolonial «Heritage» and Temporality. Third Text, 2019.

Zu den Autorinnen
Philine Erni ist Kunst- und Literaturwissenschaftlerin und forscht aktuell anhand ihrer eigenen Familiengeschichte zur Erinnerungskultur Indonesiens zwischen 1900–1956. Sie arbeitet seit über zehn Jahren bei diversen Schweizer Kulturinstitutionen und -festivals im Bereich der Kommunikation und Vermittlung, aktuell unter anderem als Projektleiterin des Symposiums Frauen* im Literaturbetrieb, für Fantoche oder Migros Kulturprozent und ab der Spielzeit 2022/23 als Teil des Leitungsteams des Theaters Winkelwiese.
Sarah Grossenbacher hat Geschichte und Soziologie studiert und einen MAS in Raumplanung an der ETH Zürich absolviert. Seit zehn Jahren arbeitet sie bei der Stadtplanung Luzern, seit 2019 als Co-Leiterin der Dienstabteilung. An der Schnittstelle zur Politik beschäftigt sie sich unter anderem mit Fragen und Projekten zum öffentlichen Raum und verfügt über vielfältige Erfahrungen im Bereich der Partizipation. Fragen, wie Entscheidungsprozesse und insbesondere Interessenabwägungen erfolgen, beschäftigen sie sowohl in ihrem Beruf als auch in ihrer MAS-Thesis zum Thema Innenentwicklung.

Rachel Huber ist Historikerin und schliesst derzeit ihre Promotion zum Sichtbarmachen der unterdrückten Seiten von Meistererzählungen anhand Born-Digital-Egodokumenten und klassischen Quellen ab. Sie ist an der Uni Luzern angestellt und forscht und lehrt am Lehrstuhl der Moderne. 2019 veröffentlichte sie das Essay «‹General Sutter› – die obskure Seite einer Schweizer Heldenerzählung», das unter anderem Grundlage für die Schweizer Denkmaldebatte um das vielschichtige Denkmal «General Sutter» wurde. Sie ist Co-Gründerin des Historikerinnennetzwerks Schweiz.

Vera Ryser ist freischaffende Kuratorin, Ausstellungsmacherin und Literaturwissenschaftlerin. Sie arbeitet an transdisziplinären Projekten zwischen Forschung, Vermittlung und Kunst und beschäftigt sich mit dekolonialen Praktiken, feministischem Widerstand und migrantischen Diskursen. Unter anderem hat sie das Projekt «Das Wandbild muss weg!» mitinitiiert, um damit eine gesellschaftsübergreifende Debatte zum schweizerischen Kulturerbe der Kolonialzeit anzustossen.
Titelbild
Imago | Copyright: xDanielxKimx
Open Access
Dies ist eine Open-Access-Publikation, lizenziert unter CreativeCommons CC BY-SA 4.0.
Anmerkung der Redaktion
Die Blogbeiträge können Meinungsäusserungen der AutorInnen enthalten und stellen nicht grundsätzlich die Position der jeweiligen Arbeitgeberin oder der SAGW dar.