Von Christian Wyler
Vor zwanzig Jahren, am 20. März 2003, eröffnete eine US-amerikanisch geführte Militärkoalition den Krieg gegen den Irak. Die Bilder von Explosionen und Feuerbällen zwischen den nächtlichen Gebäudesilhouetten Bagdads wurden rasch verdrängt von Siegerposen und Schulterklopfen: Bereits am 1. Mai erklärte der damalige US-Präsident George W. Bush den Krieg für beendet und verkündete von einem Flugzeugträger aus: «Mission erfüllt.»
Der vermeintlich erfolgreiche Einmarsch entpuppte sich in den folgenden Jahren als Desaster historischen Ausmasses. Das Land versank in Krieg, Regierungsversagen und Korruption. Es ist schwierig zu beziffern, wie viele Opfer die Gewalt im Irak seither gefordert hat. Das Projekt «Iraq Body Count» geht von aktuell über 200'000 zivilen Opfern aus. Eine andere Studie sah bereits Mitte 2006 die Zahl von 600'000 Gewaltopfern überschritten.
Die Mär vom «tausendjährigen Krieg»
Als Grund für die Gewalt wird oft auf die beiden grossen islamischen Konfessionen Schia und Sunna verwiesen, die im Irak einen religiösen Konflikt austragen würden. Dieser «reiche Jahrtausende zurück», meinte 2016 selbst der damalige US-Präsident Barak Obama. Diese Erklärung, so oft und prominent sie auch angeführt wird, ist falsch. Sie gründet auf der Vorstellung, dass ein Staat mit einer konfessionell und ethnisch heterogenen Bevölkerung zwangsläufig anfällig für Konflikte ist. Gemäss diesem Bild sind Menschen durch ihre Religion determiniert: Ein Schiit ist in erster Linie Schiit, und diese Zugehörigkeit wird alle seine Entscheidungen bestimmen. Diese im Grunde rassistische Annahme spricht den Menschen im Nahen Osten nicht nur eine komplexe Identität ab, mit diversen Bezügen zu ihrer Region, Stadt, ihrem Geschlecht oder ihrer sozialen Schicht. Sie verneint auch ihre Freiheit, eine eigenständige politische Meinung zu haben – und erst recht, diese Meinung im Verlauf der Zeit womöglich zu ändern.
Die jüngsten Konflikte im Irak wurzeln jedoch nicht in jahrtausendealten Feindschaften. Sie sind viel mehr ein Produkt der Gegenwart, des gewaltigen politischen und gesellschaftlichen Umbruchs, den das Land seit dem Regimewechsel von 2003 durchläuft. Sie sind Teil eines Aushandlungsprozesses, bei dem verschiedenste Akteure um das politische System ringen, darum, wie der Irak künftig als Staat ausgestaltet sein soll.
Die Suche nach einem neuen politischen System
Auf welchen Grundlagen basiert ein funktionierender Staat? Diese Frage ist nicht nur für den Irak relevant, auch wenn sie dort nach dem Ende des Baath-Regimes besonders dringlich war. Sie beschäftigt Gesellschaften weltweit und ist selbst in etablierten Demokratien nicht abschliessend beantwortet: Grundlegende philosophische Theorien beschäftigen sich mit ihr, etwa bei John Rawls, Jürgen Habermas oder Jacques Derrida; politische Verwerfungen wie in den USA unter dem früheren Präsidenten Donald Trump, oder die Erfolge rechtspopulistischer Strömungen in zahlreichen europäischen Ländern zeigen, wie umkämpft das Verständnis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ist.
Im Irak stand man nach dem Sturz Saddam Husseins vor einer doppelten Herausforderung: Einen Staat neu aufzubauen, ohne dabei auf etablierte Strukturen zurückgreifen zu können, und die gesellschaftlichen Grundlagen festzulegen, auf die sich dieser Staat stützen sollte. Denn als nach Jahrzehnten der Diktatur das alte Regime innerhalb kürzester Zeit zusammenbrach, gab es im Irak keine funktionierende Zivilgesellschaft. Die politischen Parteien, die aus dem Exil zurückkehrten, waren in der Bevölkerung wenig verankert. Im Irak liessen sich die global aktuellen Fragen um die Legitimation einer Demokratie wie unter einem Brennglas zu beobachten.
Demokratie für den Irak – aber was für eine?
Die Bilder sollten einen Neuanfang markieren: Die Statue Saddam Husseins, die unter Jubelrufen gestürzt wird. Die Filmaufnahmen des früheren Diktators, der, bärtig und dreckverschmiert, von US-Streitkräften in einem Erdloch aufgestöbert worden war. Doch ein neues politisches System aufzubauen, sollte sich als wesentlich schwierigere Aufgabe erweisen, als einen Diktator zu stürzen.
Eine Demokratie zu errichten war für die USA das letzte verbliebene Argument, um die Invasion zu rechtfertigen – nachdem sich weder Massenvernichtungswaffen noch Hinweise auf Verbindungen des alten Regimes zum internationalen Terrorismus hatten finden lassen.
Da der Irak in den Augen der US-Verwaltung durch den «ewigen» Krieg zwischen Schia und Sunna geprägt war, bestand für sie kein Zweifel daran, wie das neue System aufgebaut werden musste: Die politische Macht sollte gerecht zwischen Sunnit:innen, Schiit:innen, Kurd:innen sowie ethnischen und religiösen Minderheiten verteilt werden, entsprechend ihrer Anteile in der Bevölkerung. Nur so könne ein friedliches Zusammenleben der verschiedenen Gruppen garantiert werden.
Damit erhielt die Zugehörigkeit zu einer Bevölkerungsgruppe den Vorrang vor anderen Ebenen der Repräsentation – insbesondere vor konkreten politischen Inhalten. Schia und Sunna waren die bestimmenden Kategorien, während politische Ausrichtungen und Visionen kaum eine Rolle spielten. Dementsprechend waren im Übergangsrat, den die US-Verwaltung einsetzte, für die Schia am meisten Sitze reserviert. Darauf folgten die sunnitisch-arabischen, dann die kurdischen Vertreter:innen und schliesslich verschiedene Minderheiten.
Auch die neue irakische Verfassung, die von diesem Rat erarbeitet wurde, orientiert sich an diesen Bevölkerungsgruppen. Der Irak wird darin als Einheit seiner verschiedenen «ethnischen und religiösen Teile» beschrieben, die alle am neuen System Anteil haben sollten. Nie zuvor war im Irak die konfessionelle oder ethnische Zugehörigkeit derart positiv in Wert gesetzt worden.
Es war aber nicht so, dass sich nur die US-amerikanische Verwaltung an der Einteilung der irakischen Bevölkerung in Schia und Sunna orientiert und dem Irak ein entsprechendes politisches System aufgezwungen hätte. Auch die schiitischen Parteien waren konfessionell ausgerichtet. Sie beanspruchten, die schiitische Bevölkerungsmehrheit zu repräsentieren und positionierten sich auf diese Weise als Zentrum des neuen Systems.
Widerstand gegen die neue Regierung
Die US-amerikanische Besatzung und die neue irakische Regierung stiessen umgehend auf bewaffneten Widerstand. Dieser war unter anderem eine Reaktion auf einige schwerwiegende strategische Fehler, die die US-Verwaltung nach der Invasion beging. Der gravierendste war ihr Umgang mit Angehörigen des früheren Regimes. Die Übergangsverwaltung hatte die irakische Armee aufgelöst und damit zahlreiche, vor allem sunnitische Soldaten und höhere Kader ihrer Existenzgrundlage beraubt. Auch die sogenannte De-Baathifizierung, in deren Rahmen Angehörige der Baath-Partei aus dem Verwaltungsapparat entfernt wurden, erlebte die sunnitische Bevölkerung als Siegerjustiz der schiitischen Parteien. Der Zulauf zu Widerstandsgruppen und ultraislamischen Kampfbünden, unter denen sich al-Qaida im Irak (AQI) bald mit besonderer Brutalität hervortun sollte, war beträchtlich. Kaum war der Krieg offiziell beendet, kam es im August 2003 zu den ersten grossen Sprengstoffanschlägen. Es war der Auftakt zum Bombenterror der kommenden Jahre.
Aber auch längst nicht alle Schiit:innen feierten die Amerikaner als Befreier. So wurde etwa der junge Muqtada al-Sadr, Sohn eines 1999 vom Regime ermordeten einflussreichen Geistlichen, zur prägenden Figur des schiitischen Widerstands. Er profitierte von der Popularität seines Vaters und verfügte mit seiner Mahdi-Armee über eine schlagkräftige paramilitärische Einheit. Sadr war, wie bereits sein Vater, den Amerikanern gegenüber äusserst kritisch eingestellt und propagierte einen konservativ-religiösen Nationalismus.
Dieser umgehende Widerstand von schiitischer Seite zeigt, dass die Konfessionen zu keinem Zeitpunkt geschlossene Blöcke darstellten. Indem sich Sadr für einen überkonfessionellen irakischen Widerstand gegen die Besatzung einsetzte, positionierte er sich explizit gegen die irannahen schiitischen Parteien, die mit den US-Truppen zusammenarbeiteten und vom neuen, konfessionell orientierten System profitierten. Der innerschiitische Machtkampf zwischen den Sadristen und den schiitischen Parteien prägt den Irak bis heute.
Noch schwieriger war die Situation auf sunnitischer Seite. Die sunnitischen Parteien genossen nur wenig Rückhalt in der Bevölkerung. Es gab weder eine explizit sunnitische Kollektividentität noch Institutionn, die die gesamte sunnitische Bevölkerung umfassten. Die Sunna musste sich als Konfession erst herausbilden – ein Prozess, der auch 20 Jahre nach dem Regimewechsel noch nicht abgeschlossen ist.
Die Zeit der Betonwände
Ab den ersten Wahlen 2005 dominierten die schiitischen Parteien die institutionelle Politik, die mit dem Sturz des Baath-Regimes aus ihrem jahrzehntelangen Exil zurückgekehrt waren. Bald durchdrangen ihre bewaffneten Flügel die Sicherheitskräfte und terrorisierten die sunnitische Zivilbevölkerung mit Verhaftungen, Entführungen und Folter. Sie machten die Sunniten insgesamt verantwortlich für die Sprengstoffanschläge von al-Qaida im Irak (AQI) und anderen Kampfbünden gegen die schiitische Zivilbevölkerung. AQI verfolgte mit diesen Anschlägen erklärtermassen die Strategie, schiitische Gegengewalt zu provozieren und so einen offenen Krieg zwischen Schia und Sunna herbeizuführen.
Dieses Ziel wurde im Februar 2006 erreicht. Der Anschlag auf den Askari-Schrein in Samarra, eine der bedeutendsten schiitischen religiösen Stätten Iraks, löste eine Welle der Gewalt gegen die sunnitische Bevölkerung aus. Was folgte, wurde fortan als «konfessioneller Bürgerkrieg» bezeichnet: 2006 und 2007 forderte die Gewalt jeden Monat hunderte, manchmal tausende Todesopfer. Sie vertiefte die konfessionellen Gräben und erzeugte Hass zwischen Menschen, die sich noch wenige Jahre zuvor ihrer konfessionellen Zugehörigkeit kaum bewusst gewesen waren. Meterhohe Betonwände, die vor Anschlägen schützen sollten, trennten die verschiedenen Stadtteile Bagdads und wurden zu Symbolen der Spaltung.
Die Sunnit:innen wenden sich ab
2008 ebbte die Gewalt ab. Neben einer massiven Aufstockung der US-Truppen, war es vor allem eine neu geschmiedete Koalition aus sunnitischen Stämmen, deren bewaffnete Einheiten gegen die sunnitischen Extremisten vorgingen und so die Gewalt eindämmten.
Doch die politische Elite ging fahrlässig mit der erreichten Stabilisierung um. Im konfessionellen System waren Allianzen im Parlament kaum an gemeinsame politische Inhalte geknüpft. So verkam die Koalitionsbildung nach den Parlamentswahlen von 2010 zum Postenschacher, das politische System blieb monatelang blockiert. Hinzu kam, dass Premierminister Nuri al-Maliki sich zudem zusehends autoritär gebärdete. Er instrumentalisierte die Justiz, um gegen politische Gegner vorzugehen und liess prominente sunnitische Politiker unter dem Vorwurf früherer Baath-Verbindungen und Terrorismusunterstützung verhaften.
Die Bagdader Machtkämpfe führten zu regierungskritischen Protesten in der sunnitischen Provinz Anbar. Als Sicherheitskräfte die Demonstrationen gewaltsam unterdrückten, fühlte sich die sunnitische Bevölkerung endgültig vom neuen Irak ausgeschlossen. Bezeichnend dafür waren die Aussagen von Demonstrat:innen, man habe kein grundsätzliches Problem mit einem schiitischen Premierminister, aber man habe eines mit diesem spezifischen, Nuri al-Maliki, der die sunnitische Bevölkerung unterdrücke. Die Hoffnung auf eine Verbesserung des 2003 etablierten Systems waren bitter enttäuscht worden.
«Kalifat» statt Irak: Der IS
Es war diese Enttäuschung, die zahlreiche Sunnit:innen dazu brachte, Anfang 2014 den Vormarsch des ultraislamischen Kampfbundes «Islamischer Staat im Irak und der Levante», (ISIL, später nur noch «Islamischer Staat», IS) zu begrüssen. Der IS hatte es sich zum Ziel gesetzt, die bestehenden nationalstaatlichen Grenzen aufzuheben und, wie es seine Propaganda-Abteilung nannte, stattdessen ein «Kalifat» zu errichten. Es war das bislang radikalste Gegenmodell zum politischen System nach 2003.
Selbst für den gewaltgeplagten Irak stellte das Vorgehen des IS eine neue Dimension der Brutalität dar. Der IS inszenierte seine Gewalt propagandistisch und verbreitete Aufnahmen von Enthauptungen, Kreuzigungen und gar Verbrennungen. Gegen die jesidische Bevölkerung verübten sie ein Genozid, Frauen und Mädchen gerieten zu Tausenden in die Sklaverei. Doch der Hauptfeind des IS – daran liess seine Propaganda keinen Zweifel – war die Schia. Der IS war angetreten, um die Muslime in einem weltweiten Kalifat zu vereinen – doch seine Vorstellung von Einheit gründete auf konfessioneller Gewalt.
Der Krieg gegen den IS wurde in der irakischen Öffentlichkeit als Kampf des vereinigten Iraks gegen «Terroristen» dargestellt. Als der damalige Ministerpräsident Haidar al-Abadi im Dezember 2017 den Sieg über die Terrormiliz verkündete, feierten die Menschen dementsprechend euphorisch, ganz besonders auch jene in den mehrheitlich sunnitisch geprägten Landesteilen, wie etwa in der Stadt Mossul, die drei Jahre lang unter der Gewalt und dem Terror des IS gelebt und gelitten hatte. Für die Frage aber, warum der IS überhaupt Rückhalt in Teilen der Bevölkerung hatte gewinnen können, war zwischen Siegestaumel und irakischem Fahnenmeer kein Platz. Der militärische Sieg ersetzte das Bemühen um eine Versöhnung der gespaltenen Bevölkerung.
«Volk» gegen «Staat»
Trotz des Sieges über den IS, nahm im Dezember 2017 auch in den schiitischen Gebieten die Unzufriedenheit mit der Regierung zu. Der Leistungsausweis der schiitischen Parteien in Bagdad war katastrophal. Die Infrastruktur lag am Boden, besonders im Süden des Landes funktionierte nicht einmal mehr die Trinkwasserversorgung. Da die Parteien jenseits der konfessionellen Repräsentation kaum Inhalte zu bieten hatten, fehlte es ihnen auch an Strategien, um mit diesen Herausforderungen umzugehen. Die grassierende Korruption erschwerte die Situation zusätzlich.
Im Oktober 2019 begannen in Bagdad und den südlichen Landesteilen Massenproteste, die eine grundlegende Veränderung des politischen Systems forderten. Insbesondere die schiitische Jugend, darunter viele Frauen, gingen auf die Strasse, wütend über ihre wirtschaftliche Misere und die berufliche Perspektivlosigkeit. Die Proteste wurden in allen Landesteilen und durch alle Bevölkerungsschichten hindurch unterstützt, zivilgesellschaftliche Gruppen und einige kleinere Parteien solidarisierten sich mit den Demonstrant:innen und beteiligten sich an den Protesten.
Die Protestcamps wurden zu Diskussionsforen. Politische Fragen, aber auch gesellschaftliche Themen und besonders die Stellung von Frauen in der irakischen Gesellschaft, wurden in eigens dafür gedruckten Zeitungen eifrig debattiert. Konservative Positionen waren dabei ebenso vertreten wie progressive. So vielfältig ihre Ansichten auch waren, in einem waren sich die Menschen einig: Der «Konfessionalismus» und jegliche auf Zugehörigkeit basierenden Quoten sollten abgeschafft werden. Der Unterscheidung in Schia und Sunna hielten die Demonstrant:innen die Einteilung in «Staat» und «Volk» entgegen – ein vereinigtes «Volk», das den Anspruch auf sein Land erhebt und den «Staat» auf eine reine Verwaltungsfunktion reduziert.
Doch die Proteste blieben ohne klare Führung und Organisation. Gleichzeitig war die Gewalt gegen die Demonstrationen massiv. Sie ging von den irannahen «Haschd»-Milizen aus, einem Konglomerat aus zeitweise über sechzig paramilitärischen Einheiten, die im Kampf gegen den IS eine bedeutende Rolle spielten. Dass schiitische Einheiten, die ursprünglich die Bevölkerung gegen den IS verteidigen sollten, nun auf die schiitische Jugend schossen, war für viele im Irak ein Schock. Aus den ehemals gefeierten Rettern des Staates ist nach dem Krieg gegen das «Kalifat» selbst ein Parallelstaat geworden: Die Haschd bereichern sich dank militärischer Stärke und Unterstützung aus dem benachbarten Iran an Checkpoints und Grenzübergängen und führen gar eigene Gefängnisse. Durch die systemkritischen Proteste sahen die Haschd dieses Erfolgsmodell bedroht, der Iran fürchtete um seinen Einfluss. Indem sie gegen die Demonstrationen vorgingen und zivilgesellschaftliche Aktivist:innen noch immer unter Druck setzen, entführen und ermorden, haben sie klargemacht, dass sie ihre Position mit Waffengewalt verteidigen werden.
Die Krise der Repräsentation und die Suche nach dem Souverän
Bis heute besteht das gemeinsame Element der Debatten in der irakischen Öffentlichkeit um die Grundlagen der Staatlichkeit darin, dass weit weniger nach den politischen Werten und Zielen gefragt wird, also danach, «was» die Grundlagen des Staates sind, sondern «wer» diesen repräsentiert. Umstritten ist, wie dieses «wer», dieser Souverän, zu beschreiben sei: Ist es die (konfessionelle) «Mehrheit», wie die mächtigen schiitischen Parteien argumentieren? Sind es die diversen «Bevölkerungsgruppen», wie es das politische System nach 2003 vorsieht? Sind es gar sich religiös-politisch legitimierende Führungspersonen, wie beim IS? Oder das «Volk», wie die Demonstrant:innen von 2019 fordern?
Im Irak wird also wesentlich mehr über konfessionelle Zugehörigkeit und deren Rolle im politischen System diskutiert als zwischen den Gruppen über konfessionelle Differenzen. «Politische» Inhalte im engeren Sinn und Lösungsvorschläge zu konkreten Problemen spielen dagegen kaum eine Rolle. Die Suche nach dem «richtigen» Souverän, der «richtigen» Kategorisierung der Menschen im Irak, ist zum bestimmenden Element der öffentlichen Debatte der vergangenen zwanzig Jahre geworden. Weder die amerikanische Verwaltung noch die verschiedenen irakischen Akteure haben seither eine Alternative dazu geliefert. Die Gewalt, die Schwäche des Staates und dessen Ablehnung in weiten Teilen der Bevölkerung zeigen: Gescheitert ist die Idee, Politik entlang der Zugehörigkeit zu einer Bevölkerungsgruppe zu organisieren.
Die Dynamik dieser Entwicklungen offenbarte sich jüngst im kurdisch verwalteten Teil des Iraks. Während die eigene Unabhängigkeit jahrzehntelang als oberstes Ziel der kurdischen Bevölkerungsgruppe galt, hat eine aktuelle Umfrage Erstaunliches ergeben: Eine Mehrheit der Befragten glaubt, es würde den Menschen in Kurdistan besser gehen, wenn das Gebiet statt der kurdischen Selbstverwaltung der Regierung in Bagdad unterstellt würde – derart desillusioniert ist die Bevölkerung angesichts des autoritären Gebarens und der Korruption der kurdischen politischen Elite. Wie auch in der restlichen irakischen Öffentlichkeit, hat selbst im kurdischen Kontext die Orientierung an ethnischer Zugehörigkeit an Glanz verloren. Die Vorstellung des Staates als Repräsentation einer ethnisch oder konfessionell definierten Nation neigt sich ihrem Ende entgegen.
Dieser Text erscheint in Kooperation mit dem Online-Magazin Geschichte der Gegenwart.
Christian Wyler wurde an der Universität Bern 2022 über die Konfessionalisierung im Irak nach 2003 promoviert. Von 2019 bis 2023 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forum Islam und Naher Osten (FINO) der Universität Bern. Davor studierte er in Bern Neuste Geschichte und Islamwissenschaft. Christian Wylers Texte erscheinen unter anderem auf Journal21.
Weiterführende Literatur:
Bishara, Azmi, Sectarianism Without Sects, La Vergne 2021.
Dodge, Toby und Mansour, Renad (2021): Politically sanctioned corruption and barriers to reform in Iraq. Research Paper, Middle East and North Africa Program.
Haddad, Fanar (2016): Shia-centric State-Building and Sunni Rejection in Post 2003 Iraq, Carnegie Endowment for International Peace.
Tabaqchali, Ahmed (2020): How Demographics Erode the Patronage Buying Power of Iraq’s Muhasasa Ta’ifia. Bawader, Arab Reform Initiative.
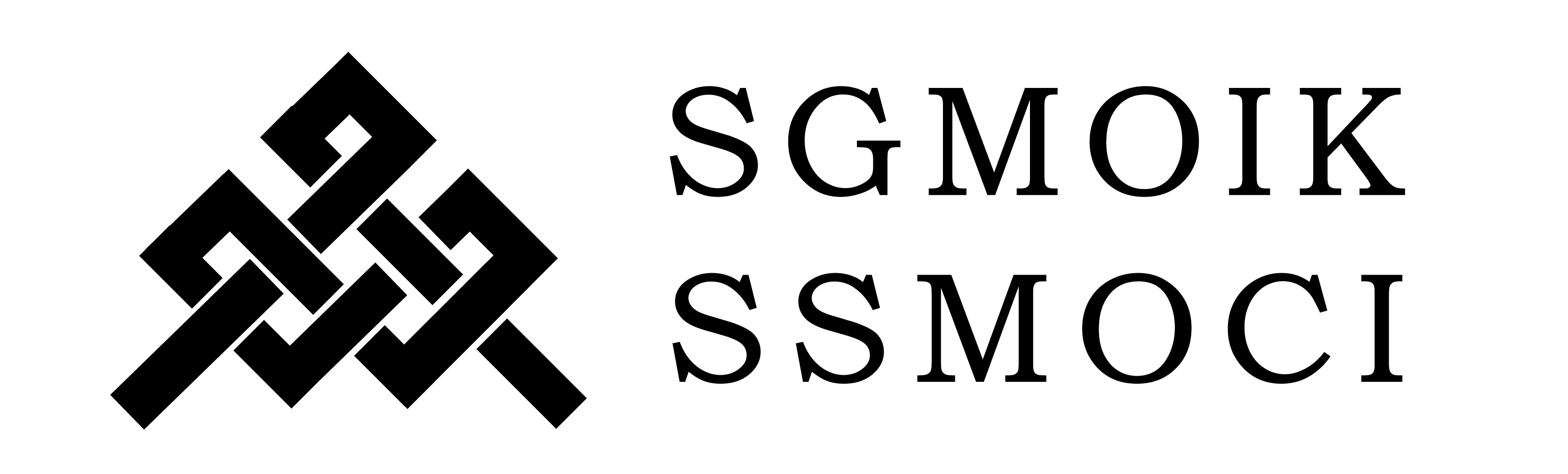

Sei der erste der kommentiert