Von Maurus Reinkowski
Eine fatal gescheiterte Mission
Mitte August 2021 fiel Kabul in die Hände der Taliban. Am 31. August 2021 verliessen die letzten am Flughafen Kabul verbliebenen US-Truppen das Land, wenige Wochen, bevor die westlichen Staaten das Jubiläum einer zwanzigjährigen militärischen Anwesenheit am Hindukusch hätten begehen – oder besser, betrauern – können. Denn seine Ziele hat der Westen nicht annähernd erreicht: Al-Qaida mag zerschlagen sein, aber die Taliban sind es nicht; das Projekt, den Staat Afghanistan nicht nur zu befrieden, sondern auch zu demokratisieren, ist gescheitert.
Die Afghaninnen und Afghanen, die von den Taliban nichts halten, und das ist der grösste Teil der städtischen Bevölkerung Afghanistans, sehen sich auf den September 1996 zurückgeworfen, als die Taliban in Kabul einmarschierten und das Islamische Emirat Afghanistan begründeten. Die wenigen Fortschritte, die in den letzten zwanzig Jahren erzielt worden sind, gerade etwa die Rechte der Frauen, erscheinen wie ausgelöscht.
Nahezu 50’000 afghanische Zivilistinnen und Zivilisten sowie 3500 Soldatinnen und Soldaten der NATO-Staaten haben in dem Krieg, der seit 2001 geherrscht hat, ihr Leben verloren. Darüber hinaus wurden allein in den ersten fünf Jahren nach der Übergabe der Verantwortung für Kampfhandlungen an den afghanischen Staat im Jahr 2014 mehr als 45’000 Angehörige der afghanischen Sicherheitskräfte getötet. Geblieben ist, ausser diesen Zehntausenden von Toten und Ausgaben, die sich nur in Billionen von US-Dollar berechnen lassen, eigentlich fast nichts. Einzig die Szenen des chaotischen Abzugs vom Flughafen Kabul werden im globalen Bildgedächtnis haften bleiben. Im Vergleich dazu erscheint der Rückzug der letzten sowjetischen Truppen, die in einem langen Konvoi im Februar 1989 eine afghanisch-sowjetische Grenzbrücke über den Amudarja überquerten, geordnet.
Der Befund ist noch niederschmetternder, wenn man auf einen Zeitraum von mehr als vier Jahrzehnten zurückblickt, beginnend im Jahr 1979, dem Jahr des sowjetischen Einmarschs in Afghanistan. Denn in diesem Zeitraum ist die afghanische Bevölkerung trotz der Einwirkungen des Kriegs von rund zwölf auf nahezu vierzig Millionen gewachsen. Heute aber befindet sich ein beträchtlicher Teil im Exil, ein noch grösserer Teil lebt in Afghanistan selbst in bitterer Armut.
Zieht man also eine Bilanz der westlichen Intervention in Afghanistan, geht es nicht nur um einen verlorenen Krieg, sondern vor allem um einen gescheiterten Staatsaufbau. «Nicht die Taliban, sondern wir [also die westlichen Staaten] haben den Staat zerstört», bringt es Gilles Dorronsoro, Professor für Politikwissenschaft an der Pariser Universität Panthéon-Sorbonnne, überspitzt, aber sehr zu Recht, auf den Punkt.
Helfersindustrie mit zweifelhaften Nebenwirkungen
Das Scheitern hat verschiedene Gründe. Einer der auf den ersten Blick offensichtlichsten ist der Aufbau einer zwar gut gemeinten, letztlich aber kontraproduktiven Helferindustrie. Westliche Nicht-Regierungsorganisationen, die meisten von ihnen zweifellos mit einer ernsthaften humanitären Mission, haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten einen parallelen Arbeitsmarkt geschaffen, der dem afghanischen Staat die grössten Talente entzog. Mehr aber noch: Die vom Ausland gebrachte Hilfe war allzu oft abgehoben und realitätsfremd. Wie der amerikanische Journalist Whitlock Craig in seinem Buch The Afghanistan Papers. A Secret History of the War festhielt, lasen etwa hochbezahlte Experten während des Flugs nach Afghanistan Khaled Hosseinis Roman «Der Drachenläufer» und glaubten, dadurch in Sachen Afghanistan kundig geworden zu sein. Ein besonders anschauliches Beispiel für die Realitätsferne westlichen humanitären Strebens liefert das Scheitern der Anti-Drogen-Politik: Die zahlreichen zivilen Akteure, die gegen den Drogenanbau vorgehen wollten, konnten der lokalen Bevölkerung niemals überzeugende Alternativen zum hochlukrativen und recht einfach zu bewerkstelligenden Opiumanbau anbieten. Militärische Einheiten wiederum, wie die britische Afghanistan Special Narcotics Force, hatten nur die Zerstörung der Infrastruktur der Drogenproduktion im Blick, ohne die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen zu berücksichtigen.
Eine solche Helfersindustrie mit ihren zweifelhaften Nebenwirkungen entstand jedoch nicht erst im Zuge der westlichen Intervention in Afghanistan. Sie hatte sich bereits in den späten 1980er Jahren in Peschawar, einer Stadt im nordwestlichen Pakistan, etabliert: Zu jenem Zeitpunkt war Peschawar das Zentrum aller humanitären Operationen für das sowjetisch besetzte Afghanistan und beherbergte 66 NGOs. Damit wies die Stadt die grössten Dichte von Hilfsorganisationen in der damaligen Dritten Welt auf – es war eine Art von «humanitärer Invasion».
Der 11. September als Achsenzeit
Bemerkenswert ist, dass der 11. September 2001 eine Art Dreh- und Angelpunkt der Kriegsgeschichte Afghanistans bildet, ja sogar die Achse einer zeitlichen Symmetrie, die sich zwanzig Jahre nach hinten und zwanzig Jahre nach vorn erstreckt. So wie die Ereignisse seit 1979 – der Einmarsch der Sowjetunion, die Unterstützung der Mudschaheddin durch Pakistan, Saudi-Arabien und die USA, das Machtvakuum nach dem Abzug der Sowjets 1989 sowie der Aufstieg der Taliban und al-Qaida in den 1990er Jahren – auf den 11. September zuführten, so ist die westliche Intervention in Afghanistan in den Jahren 2001-2021 ohne 9/11 nicht vorstellbar.
Von 9/11 aus gesehen, geht die Kriegsgeschichte Afghanistans indessen bis 1979 zurück, oder besser, bis zum April 1978: Damals war die marxistisch-leninistische Demokratische Volkspartei, in den 1960er Jahren gegründet, mit einer «Revolution» an die Macht gekommen und hatte mit ihrem rücksichtslosen Programm einer Modernisierung der Gesellschaft und ihrer politischen Paranoia in Form massloser «Säuberungen» landesweiten Widerstand entfacht. Dadurch hatte sie das Land so instabil gemacht, dass sich die sowjetischen Bündnisgenossen eineinhalb Jahre später zum Eingreifen gezwungen, ja geradezu berechtigt sahen: Es ging in den Augen der sowjetischen Elite schliesslich um den Erhalt der Errungenschaften einer sozialistischen Herrschaft in einem islamischen Land – dem zweiten nach Süd-Jemen.
Die sozialistische Demokratische Volkspartei machte ähnliche Fehler, die schon Amanullah Khan, der von 1919 bis 1929 an der Macht war und ab 1926 als «König» (pādšāh) regierte, begangen hatte. Sein umfassendes Reformprogramm stiess auf Widerstand, und er liess Rebellionen der Landbevölkerung gewaltsam niederschlagen. Wie die Volkspartei ignorierte er die bestehenden sozialen Strukturen, warf die tief verankerten Geschlechterbeziehungen über den Haufen und stiess die ländliche Bevölkerung vor den Kopf. Fehler, die sich ein nicht besonders starker Staat einfach nicht hätte erlauben dürfen.
Interessanter-, oder vielleicht besser, fatalerweise beginnt die «eigentliche» Geschichte Afghanistans in den Augen der meisten Betrachter aber erst in den späten 1970er Jahren. Beispielhaft hierfür ist die im Sommer 2021 von Arte ausgestrahlte vierteilige Dokumentation «Afghanistan – Das verwundete Land». Der erste Teil der Dokumentation mit dem Titel «Königreich» versucht erst gar nicht, das 20. Jahrhundert in seiner Gesamtheit verständlich zu machen, sondern beschränkt sich darauf, die Vorgeschichte zum sowjetischen Einmarsch im Dezember 1979 zu schildern. Dabei zeigt sie ein weitgehend idealisiertes Bild eines offenen und westlich geprägten Kabuls vor Beginn des Kriegs. Dieses begrenzte Geschichtsverständnis, das sich, notabene, nicht nur in den Medien findet, ist womöglich mit ein Grund für das Scheitern des vom Westen getriebenen Staataufbaus.
Ein kriegerischer Rentierstaat
Afghanistan war bereits in der Zeit vor dem 19. Jahrhundert ein Durchgangsgebiet für Eroberer und Imperien. Dass jedoch Imperien wie Grossbritannien, die Sowjetunion, die Vereinigten Staaten und am Ende auch die NATO letztlich reihenweise an der Befriedung des Landes scheiterten, was Afghanistan die Bezeichnung «Friedhof für Imperien» einbrachte, hat mit den geänderten Ansprüchen «moderner» Staaten an die Durchsetzung einer gültigen politischen und sozialen Ordnung in allen Landesteilen zu tun. «Vormoderne» Herrscher in den Gebieten des heutigen Afghanistans waren hier in ihren Ansprüchen insofern lebensklüger, als dass sie nicht den Anspruch hatten, ein einheitliches Netz von Herrschaft, Infrastruktur und Institutionen über das gesamte Land legen zu wollen. Sie wussten, dass die Machtmittel ihrer weitgehend auf die Städte beschränkten Herrschaft dafür schlicht nicht ausreichten.
Neben diesem Bild eines militärisch unbezwingbaren Landes steht aber zugleich die Tatsache, dass sich Afghanistan seit vielen Jahrzehnten nicht aus sich selbst ernähren kann. In dem von Ahmad Schah Durrani Mitte des 18. Jahrhunderts begründeten Reich, die Keimzelle des heutigen Afghanistans, lagen die ertragreichsten Provinzen Sind, Pandschab, Khorasan und Turkestan nicht in dessen Zentrum, sondern am Rande. Diese reichen Randprovinzen gingen allmählich an den Iran, an die Konkurrenten in Zentralasien und auf dem indischen Subkontinent und schliesslich an die expandierenden britischen und russischen Imperien verloren. Seit dem 19. Jahrhundert begann sich ein neues Modell durchzusetzen, das des Rentierstaats Afghanistan, der für seinen Unterhalt vor allem auf Zuwendungen von aussen baute, von Zuwendungen des britischen Imperiums, später der Sowjetunion und ab den 1950er Jahren von den USA und von Entwicklungshilfe lebte.
Gewiss, Afghanistan ist auch ein Erbe des Imperialismus. Man sieht dies nicht nur an dem rund dreihundert Kilometer nach Osten ausgreifenden Sporn des Wachan-Korridors, der in den 1870er Jahren einen Puffer zwischen den damaligen Herrschaftsgebieten des britischen Imperiums in Südasien und dem russländischen Reich in Zentralasien bilden sollte. Ja, man könnte sogar sagen, dass Afghanistan von den Briten, auch wenn sie in den anglo-afghanischen Kriegen von 1839 bis 1842 und 1878 bis 1880 militärische Niederlagen erlitten, als wirtschaftlich und aussenpolitisch strukturell abhängiges Land geschaffen wurde und niemals aufgehobene Interessengegensätze zwischen Russland und dem Westen in die sowjetische Invasion Afghanistans mündeten.
In diesem Zusammenhang ist jedoch auf den Widerspruch hinzuweisen, dass die Bevölkerung Afghanistans seit dem 19. Jahrhundert mit religiös-ideologischen Motiven gegen ausländische Interventionen kämpfte, sich aber gleichzeitig auf die ausländische Unterstützung verlassen wollte. Ein merkwürdiger Zusammenprall von unterschiedlichen Interessen, der bis in die unmittelbare Gegenwart die afghanische politische Kultur kennzeichnet.
Dass die afghanischen politischen Eliten nicht fähig waren, weiter zu denken als in den Dimensionen ihres kurzfristigen persönlichen Vorteils, hängt mit Fehlern der westlichen Aufbaupolitik seit 2001 zusammen: Die in der afghanischen politischen Kultur endemische Korruption wurde durch die oft ohne Bedacht und Mass gewährte westliche Hilfe angefacht. Gleichzeitig gilt es jedoch festzuhalten: Die afghanische politische Elite der letzten zwanzig Jahre hat im Sommer 2021 ihr Wirtstier verloren, auch deshalb, weil sie hinsichtlich der Gefahr seines möglichen Hinscheidens zu bedenkenlos gewesen war.
Krieg ist die profitabelste Wirtschaftsform
Es ist kaum vorstellbar, dass mit dem Abzug der NATO-Truppen im August 2021 die Kriegsgeschichte Afghanistans zu einem Ende gekommen ist. Warum sollte der selbstzerstörerische Drang des Kriegs in der afghanischen Gesellschaft auf einmal vorbei sein? Neben dem Opiumanbau ist der Krieg längst zur profitabelsten Wirtschaftsform geworden. Viele Männer kennen kaum ein anderes Handwerk mehr als das des Kriegs. Zudem sind die heutigen Taliban alles andere als Sendboten des Friedens und der Versöhnung, als die sie sich gerne geben, sondern die Saat der Gewalt, die in den 1980er Jahren im Land gelegt wurde. Mehr aber noch: Für die vor allem im Norden des Landes lebenden Nicht-Paschtunen, zu deren grössten Gruppen die Tadschiken, Hazara, Usbeken und Turkmenen gehören, sind die Taliban nichts anderes als die Fortsetzung des paschtunischen Machtanspruchs der Durrani-Dynastie, die von 1747 bis 1978 geherrscht hatte – ein alter Machtanspruch, notabene, nur in einem anderen Gewand.
Die Frage der Verantwortung
Worin liegt nun die Verantwortung der westlichen Staatengemeinschaft gegenüber Afghanistan? Abgesehen vom Scheitern der Intervention von 2001, liegt ein Grossteil der Verantwortung im Desinteresse, das der Westen nach dem erzwungenen Rückzug der Sowjets 1989 am weiteren Schicksal Afghanistan zeigte. Nur ein verschwindend geringer Teil der ungeheuren Summen, die seit 2001 investiert wurden, hätten in den 1990ern vermutlich gereicht, um das Land und seine Bevölkerung wieder ins Gleichgewicht zu bringen, wenn das Ziel nicht eine militärische und politische Konsolidierung nach westlichem Vorbild gewesen wäre.
Seither pendelt die westliche Aufmerksamkeit gegenüber Afghanistan in ungesunder Weise zwischen den Polen einer rein humanitär orientierten und einer geopolitischen Sichtweise – beide sind aber auf ihre Weise entmündigend. So beklagt man einerseits, dass Frauen in Afghanistan schutzlos der erbarmungslosen Männerherrschaft der Taliban ausgeliefert sind, und kritisiert andererseits, dass der Westen nun Afghanistan einer chinesischen Vorherrschaft überantwortet habe.
Die grundsätzliche Frage, die sich aus der Geschichte Afghanistans der letzten vierzig Jahre stellt, ist: Wie und wann überwiegt eine humanitäre Intervention die Nachteile, die nationale Souveränität (die übrigens in vielen solcher Fälle gar nicht mehr existiert) zu verletzen? Ohne Zweifel ist Afghanistan in den Jahren 2001 bis 2021 der eindeutige Fall einer misslungenen und diskreditierten Intervention, die ursprünglich auch nicht von einem humanitären Anliegen, sondern von Rache für den 11. September getrieben war.
Das heisst aber nicht, dass jegliche westliche Intervention an sich abzulehnen ist. Denn aufgrund welcher ethischen Grundsätze – abgesehen von einem kompromisslosen Pazifismus – würde sich etwa die Intervention der USA in den Bosnien-Krieg 1995 überzeugend und abschliessend verurteilen lassen? Nachdem die europäischen Staaten in der ersten Hälfte der 1990er Jahre in einem Akt der Regression in die alten Machtkonstellationen vor dem Zweiten Weltkrieg, ja vor dem Ersten Weltkrieg, zurückgefallen waren und sich in die Gegensätze eines pro-kroatischen Deutschlands, eines pro-serbischen Frankreichs und eines entschieden unentschiedenes Grossbritannien verrannt hatten, beendete erst das aktive Engagement der USA den Krieg. «Dayton», die Grundlage des heutigen Bosnien-Herzegowinas, mag in vielen seiner Aspekte hochproblematisch sein. Aber was wäre die Alternative gewesen?
Heute verschwimmen die Dimensionen und Grenzen: Der Niedergang der USA als hegemoniale Ordnungsmacht und die neuen globalen Machtansprüche Chinas und Russlands machen Platz für neue, regionale nach Dominanz strebende Akteure wie Iran und die Türkei. Die früher mehr oder weniger klar eingegrenzte Konfliktzone des «Nahen Ostens» weitet sich immer mehr aus. Auffällig ist jedenfalls die «Nahostisierung» des subsaharischen Afrikas, des Kaukasus oder auch von Afghanistan und seiner Nachbarschaft.
Die Lehre, die man schon heute aus dem Desaster der Afghanistan-Intervention ziehen kann, ist, dass der Westen in Zukunft einen Beitrag zur Konsolidierung des Landes leisten und mit den Taliban kooperieren muss, ohne dass eine erneute Intervention zur Diskussion steht – selbst in Anbetracht der höchst problematischen Entwicklungen, die von dem Land erneut ausgehen könnten. Die Leitworte für eine künftige westliche Politik, allem voran für die Region eines erweiterten Nahen Ostens, müssen lauten: Bescheidener, pragmatischer, umsichtiger. Die derzeitigen Gespräche mit einer Delegation der Taliban in Oslo könnten ein Hinweis auf eine solche neue Herangehensweise sein.
Und Afghanistan? Das Land am Hindukusch ist und bleibt eine weitere Baustelle unter vielen für die in ihren Grundwerten zutiefst verunsicherte westliche Staatengemeinschaft.
Maurus Reinkowski wurde 1995 über historiographische Deutungen des spätosmanischen Palästinas promoviert; 2002 folgte die Habilitation über die osmanische Reformpolitik im 19. Jahrhundert. Von 2004 bis 2010 war er Professor für Islamwissenschaft an der Universität Freiburg i. Br.; seit 2010 ist er Professor am Seminar für Nahoststudien, Departement Gesellschaftswissenschaften, an der Universität Basel. Seine jüngste Publikation ist «Geschichte der Türkei. Von Atatürk bis zur Gegenwart» (München: C.H. Beck 2021).
Fotocredit Listenbild: Kabul, November 2021
Mohammad Husaini, Unsplash
Dieser Artikel wurde in Zusammenarbeit mit der Geschichte der Gegenwart publiziert.
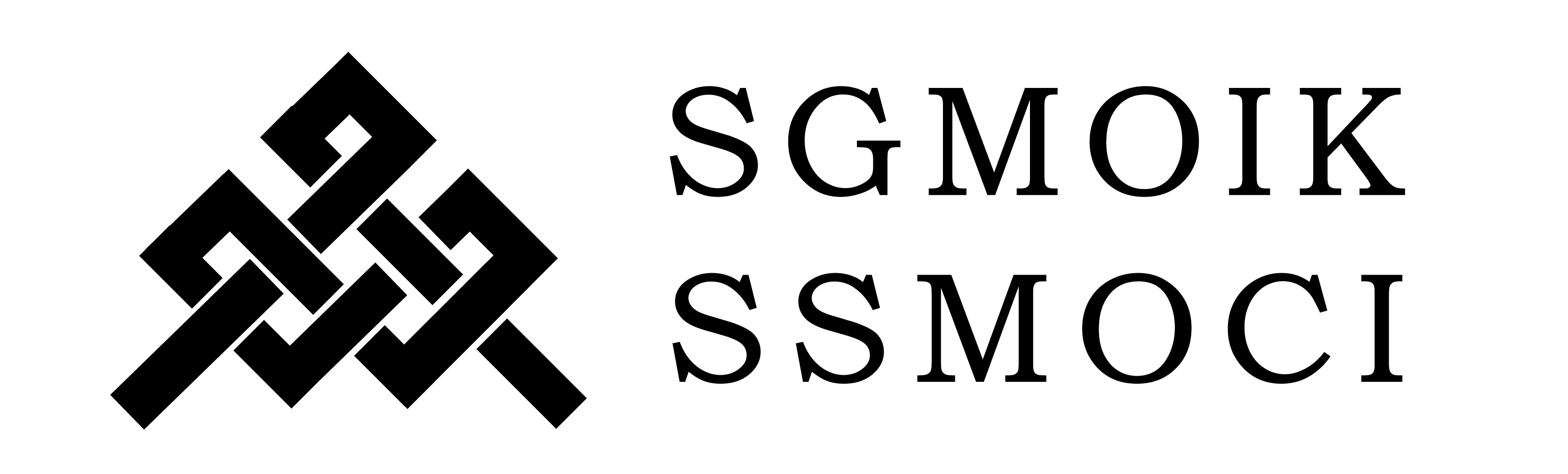

Sei der erste der kommentiert